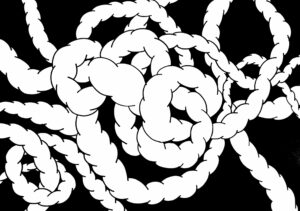Ringen um ein gemeinsames Erbe – Belarus und Litauen

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in

Tina Wünschmann wurde 1980 in Freital geboren. Sie studierte Slavistik, Politik- und Kommunikationswissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Seit 2010 übersetzt sie aus dem Belarussischen, u.a. Texte von Julia Cimafiejeva, Alhierd Bacharevič oder Volha Hapeyeva.