„Patrioten gibt’s bei euch also keine?“
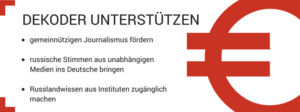
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in

Ruth Altenhofer, 1979 in Niederösterreich geboren, hat in Wien, Rostow am Don und Odessa Slawistik studiert.Nach mehreren Jahren beruflicher Tätigkeit im Bereich Flucht und Asyl ist sie seit 2015 freiberufliche Übersetzerin für Literatur, Dramatik und Autorencomics und natürlich Dekoder.Ihre Übersetzungen von Sasha Filipenkos Romanen (Diogenes Verlag) wurden mit dem Perewest-Stipendium (Die Jagd, 2021) und dem Sacher-Masoch-Preis (Der Schatten einer offenen Tür, 2025) ausgezeichnet.