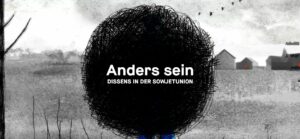„Wenn Angst aufkommt, bin ich immer dafür, sie zu überwinden“

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in

Maria Rajer wurde 1987 in Ust-Kamenogorsk (Kasachstan) geboren und immigrierte 1996 nach Deutschland. Sie studierte Slawistik und Germanistik an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg und der Humboldt Universität zu Berlin. Seit 2013 arbeitet sie als freie Übersetzerin aus dem Russischen. Zu den von ihr übersetzen Autorinnen und Autoren gehören Mascha Alechina, Dmitri Gluchowski, Wassili Grossman und Andrej Platonov.