Vom Osten lernen
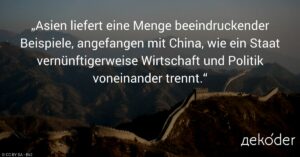
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in
Katja Wall ist in Sankt Petersburg geboren und in Deutschland aufgewachsen. Im Jahr 2000 hat sie an der Universität Mainz ihren Abschluss als Diplom-Übersetzerin für Deutsch, Russisch und Französisch gemacht. Anschließend war sie 15 Jahre lang als Projektkoordinatorin im Russland/Eurasien-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin tätig. Eines ihrer zentralen Projekte dort war die AG Zukunftswerkstatt des Petersburger Dialogs.2015 hat sich Katja Wall als Übersetzerin selbständig gemacht und übersetzt seitdem für NGOs, Verlage und Unternehmen. Darüber hinaus arbeitet sie regelmäßig als Autorin und Lektorin im Wörterbuchprogramm der PONS GmbH mit.