Wörterbuch des Krieges
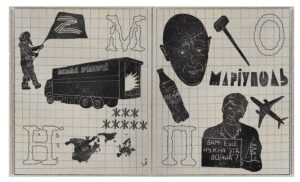
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in
Jennie Seitz wurde 1983 in Wladiwostok geboren und hat in Berlin Indologie und Religionswissenschaft studiert, bevor sie sich 2013 als freie Übersetzerin aus dem Russischen selbständig machte. Als Übersetzerin ist sie unter anderem für den gemeinnützigen Verein Kontakte-Kontakty e. V. tätig, seit der Gründung 2015 übersetzt sie für dekoder.org. Zu den von ihr übersetzten AutorInnen gehört Nadja Tolokonnikowa von der Gruppe Pussy Riot (Anleitung für eine Revolution). Zu den von ihr übersetzten Autoren gehören auch Dmitry Glukhovsky und Alexander Ilitschewski. 2023 erschien in ihrer Übersetzung Nimm meinen Schmerz von Katerina Gordeeva.