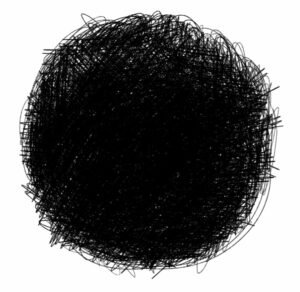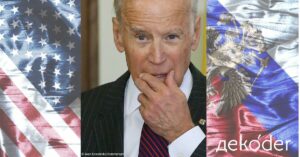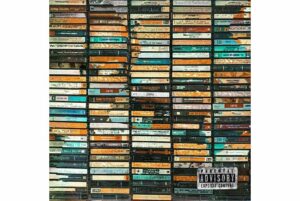Übersetzer:in
Henriette Reisner
studierte Slawistik und Neuere deutsche Literatur in Berlin und Moskau. Von 2013 bis 2018 war sie Doktorandin der Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien an der LMU München. In ihrem Promotionsprojekt untersuchte sie die Entwicklung des sowjetischen Animationsfilms im Spiegel politischer und ästhetischer Debatten. 2019 absolvierte sie den weiterbildenden Masterstudiengang „Literarisches Übersetzen“ an der LMU München und arbeitet seitdem als freie Lektorin und Übersetzerin.