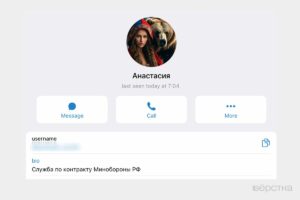Die armenisch-russischen Beziehungen

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in
Hartmut Schröder (*1967 in Bremen), studierte Slawistik und Osteuropäische Geschichte an der FU Berlin sowie Übersetzung (russisch und polnisch) an der HU Berlin. Seit 2000 arbeitet er als freiberuflicher Übersetzer in Berlin, unter anderem für den Europäischen Austausch, die Gesellschaft Memorial, die Heinrich-Böll-Stiftung und die Zeitschrift Osteuropa. Seit 2012 ist er Übersetzer und Textredakteur bei den Russland-Analysen.