„Kronos‘ Kinder“ von Sergej Lebedew
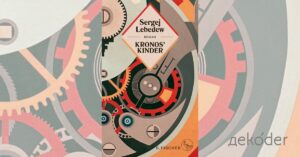
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in
Franziska Zwerg hat in Berlin und Moskau Slawistik, Germanistik und Theaterwissenschaft studiert. Seit 1994 arbeitet sie für Theater, Film und den deutsch-russischen Kulturaustausch und übersetzt heute vor allem Gegenwartsprosa und Lyrik aus dem Russischen.