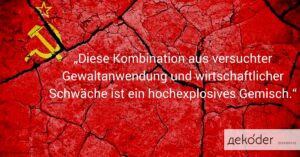Der heimliche König von Sankt Petersburg

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in

Barbara Sauser hat in Freiburg i. Ue. (Schweiz) und Kasan Slawistik und Musikwissenschaft studiert und mehrere Jahre als Lektorin und Pressebeauftragte in Verlagen gearbeitet. Seit 2009 lebt sie als Übersetzerin aus dem Italienischen, Französischen, Polnischen und Russischen in Bellinzona (Schweiz).