„Zeit, dem Informationskrieg einen Riegel vorzuschieben“
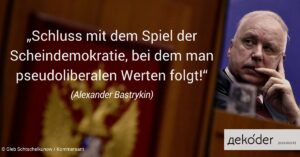
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Übersetzer:in
Anna Burck hat Russistik und Neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin und in Moskau studiert. Dort hat sie für das Goethe-Institut zwei Jahre lang den Aufbau und die Redaktion eines deutsch-russischen Online-Magazins geleitet. Nach freiberuflicher Tätigkeit als Übersetzerin und Online-Redakteurin war sie Gründerin und Co-Leiterin von Daktylos Media, einem Digitalverlag für interaktive Kinderbuch-Apps. Heute arbeitet sie als Projektleiterin für Digitalisierung in Dresden und führt nebenberuflich ihre Übersetzerinnentätigkeit weiter.