Nawalny obenauf?
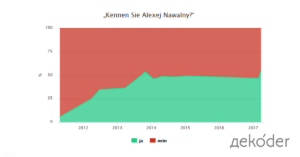
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Quelle
Die 1999 gegründete Tageszeitung Vedomosti (Auflage circa 75.000 Exemplare) spezialisiert sich auf Wirtschaftsthemen. Neben aktuellen Meldungen veröffentlicht sie häufig auch Analysen unabhängiger und kritischer Autoren, auch zu allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Themen.
Die Zeitung war bis 2015 ein Gemeinschaftsprojekt von The Wall Street Journal, Financial Times und dem russisch-finnischen Verlagshaus Independent Media Sanoma. Im Herbst 2014 wurde in Russland ein Gesetz verabschiedet, dass es ausländischen Investoren verbot, mehr als 20 Prozent einer russischen Medienanstalt zu besitzen. Alle drei Anteilseigner mussten deshalb ihre Aktien verkaufen. Im November 2015 kaufte der russische Unternehmer und Medienmanager Demjan Kudrjawzew das Aktienpaket, das Blatt durfte jedoch weiterhin Materialien von Financial Times und The Wall Street Journal nutzen.
Im März 2020 wurde bekannt, dass die Inhabergesellschaft um Kudrjawzew Vedomosti an den Verleger Konstantin Sjatkow und den Investment-Manager Alexej Golubowitsch verkauft hat, beide gelten als kremlnah. Sjatkow und Golubowitsch stiegen aus dem Geschäft jedoch aus, Ende Mai 2020 wurde der Unternehmer Iwan Jeremin zum alleinigen offiziellen Eigentümer von Vedomosti. Jeremin ist unter anderem Gründer und Generaldirektor der kremlnahen Nachrichtenagentur FederalPress.
Im März 2020 verließ Chefredakteur Nikolaj Bulawinow die Zeitung, Anfang Juni 2020 kehrten fünf weitere Mitarbeiter Vedomosti den Rücken.
Eckdaten
Gegründet: 1999
Gründer: Derk Sauer
Chefredakteurin: Irina Kasmina
Herausgeber: Gleb Prosorow
URL: www.vedomosti.ru