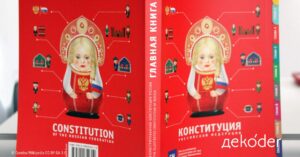Quelle
The New Times
Die Geschichte von The New Times/Nowoje Wremja geht bis in die Sowjetzeit zurück. Sie wurde 1943 als Zeitung unter dem Titel Woina i rabotschi Klass (dt. „Krieg und Arbeiterklasse“) gegründet und zunächst 1947 in Nowoje Wremja (dt. „Moderne Zeit“), später dann 1998 in The New Times umbenannt.
Heute ist The New Times ein Wochenmagazin mit einer Auflage von rund 50.000 Exemplaren. Da die Druckkosten zu hoch waren, erscheint es seit Mitte 2017 nur noch im pdf-Format. Auf dem zugehören Portal newtimes.ru werden zudem laufend aktuelle Interviews, Nachrichten, Videos etc. veröffentlicht.
Chefredakteurin (seit 2009) und Herausgeberin (seit 2013) der Zeitschrift ist Yevgenia Albats, eine einflussreiche und prominente Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Sie spielt auch durch ihr wöchentliches politisches Radiofeature Polny Albats (dt. etwa „Die ganze Arbats“) auf Radio Echo Moskwy, wo sie außerdem auch als Expertin in der Sendung Ossoboje Mnenije (dt. „Besondere Meinung“) auftritt, eine wichtige Rolle im politischen Diskurs. The New Times trägt in vielem ihre Handschrift, gerade in programmatischer Hinsicht.
The New Times ist eines der führenden oppositionellen Medien in Russland. Das Magazin ist für seine eindeutig regierungskritische Einstellung bekannt und positioniert sich als „Zeitschrift von freien Journalisten für freie Menschen“. Für The New Times schreiben anerkannte oppositionelle Journalisten, Wissenschaftler und Schriftsteller. In manchen Fällen hatten Journalisten aufgrund von Veröffentlichungen in The New Times mit politisch motivierten Schwierigkeiten zu kämpfen, so wurde Natalja Morar, die moldauische Staatsbürgerin ist, 2007 nach einem Artikel über die „schwarze Kasse des Kreml“ die Wiedereinreise nach Russland verweigert.
Im Oktober 2018 wurde Albats und The New Times zu einer Geldstrafe in Höhe von über 22 Millionen Rubel (rund 300.000 Euro) verurteilt. Es war die höchste Strafe, die je gegen ein russisches Medium verhängt wurde. Hintergrund war eine im November 2017 beschlossene Änderung im Mediengesetz, womit Medien alle Zuwendungen von ausländischen Geldgebern deklarieren müssen. Diese Deklaration habe The New Times nicht vorschriftsmäßig durchgeführt, so die Begründung des Gerichts. The New Times startete eine Crowdfunding-Kampagne und sammelte innerhalb von nur vier Tagen knapp 27 Millionen Rubel ein – deutlich mehr als die erforderliche Summe.
Am 28. Februar 2022 gab The New Times bekannt, dass ihre Website in Russland gesperrt wurde. Als Grund wurde eine Veröffentlichung genannt, die über mögliche Verluste in der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine informierte. Zu dem Zeitpunkt hatte das russische Verteidigungsministerium noch keine Toten in den eigenen Reihen eingeräumt.
Eckdaten:
Gegründet: 1998 (Vorgänger Nowoje Wremja: 1943)
Chefredakteur: Yevgenia Albats
Herausgeberin: Yevgenia Albats
URL: www.newtimes.ru