HIV-Epidemie in Jekaterinburg?
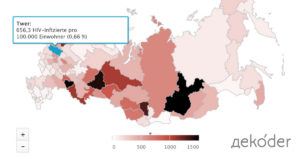
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Quelle
Slon ist ein Nachrichtenportal aus der gleichen Mediaholding wie der Fernsehsender Dozhd und die Online-Zeitschrift Bolshoj gorod. Auf dem Portal werden nicht nur Nachrichten, sondern – vor allem als Premium-Inhalte – auch Analysen, Reportagen und Kommentare von namhaften Gastautoren publiziert. Die Ausrichtung des Mediums ist gemäßigt oppositionell, die Zielgruppe besteht hauptsächlich aus urban professionals. Schwerpunkt des Portals sind Themen aus dem Bereich Wirtschaft und Politik.
Das Portal wurde 2009 von den Journalisten Leonid Berschidskij und Olga Romanova (beide nicht mehr am Projekt beteiligt) gegründet. Seit dem 6. November 2016 nennt sich das Portal Republic.
Eckdaten
Gegründet: 2009
Chefredakteur: Maxim Kaschulinski
Investor und Direktor: Aleksandr Vinokurov
URL: www.slon.ru, nach der Umbenennung: www.republic.ru