Corona-Politik: Eine einzige Misere
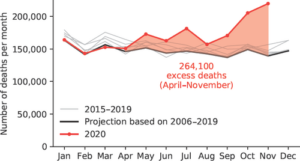
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Quelle
Verhaftungen, Anklagen, Korruptionsfälle – Rosbalt liefert als Nachrichtenagentur und Onlinemedium verstärkt News zu Kriminalität mit Polit-Bezug, aber auch zu aufsehenerregenden Ermittlungsfällen (nicht nur) in Russland. Es ist ein Medienprojekt, das eine Nische besetzt und meist unter dem Radar einer breiten (Netz-)Öffentlichkeit fliegt. Wie viele weitere unabhängige Medien wurde Rosbalt 2021 auf die Liste der sogenannten „ausländischen Agenten“ gesetzt
Rosbalt berichtet über aktuelle Themen zu Politik, Wirtschaft und innerer Sicherheit, hat sich während der Corona-Pandemie aber auch Themen wie Gesundheit geöffnet. Dabei ist die Nachrichtenagentur einem größeren Publikum kaum bekannt. In seiner 20-jährigen Geschichte hat sich Rosbalt einen Namen mit Informationen gemacht, die insbesondere aus Sicherheits-, Strafverfolgungs- und Geheimdienstkreisen kommen. Sobald andere Medien diese aufgreifen, werden sie über das eigene Publikum hinaus sehr viel breiter wahrgenommen.
Solche Hard News bei Rosbalt sind vorwiegend Berichte zu Verhaftungen von Korruptions- und Mordverdächtigen, Postenkarussells im Staatsdienst oder zu Ermittlungen gegen Angehörige der Silowiki – auch in den Regionen Russlands oder im Ausland, wo sonst nicht jeder hinschaut.
Zum Fall Skripal etwa berichtete Rosbalt im Oktober 2018 unter Verweis auf Quellen beim Inlandsgeheimdienst FSB, dass zwei Mitarbeiter aus Grenz- und Steuerbehörden verdächtigt werden, brisante Daten zu den mutmaßlichen Attentätern weitergegeben zu haben. Rosbalt berichtete auch als erstes Medium, dass der Kopf der berüchtigten russischen Hackergruppe namens Shaltai-Boltai vom FSB verhaftet wurde. Der Führungsriege in Russland war diese Gruppe mindestens lästig geworden, weil sie Chatprotokolle hoher russischer Regierungsbeamter geleakt hatte.
Im Herbst 2021 hat das russische Justizministerium Rosbalt als „ausländischen Agenten” eingestuft. Diesen Stempel der Regierungsbehörden tragen mittlerweile dutzende kritische Medien(schaffende) im Land. Der langjährige Chefredakteur Nikolaj Uljanow erklärte daraufhin, Geld aus dem Ausland erhalte die Agentur nicht und sie werde weiter um ihre Unabhängigkeit kämpfen, „für uns, für unsere Leser“.
Dabei liefert Rosbalt nicht täglich irgendwelche großen Coups, sondern verfolgt vielmehr laufende Entwicklungen, auch kleine Wendungen einer Geschichte. Einige der bedeutenderen Recherchen liegen teils Jahre zurück: So brachte Rosbalt rund um die Ermittlungen zum Mord an dem prominenten Oppositionspolitiker Boris Nemzow immer wieder neue Details ans Licht. Doch Rosbalt hält sich – und wächst nach eigenen Angaben sogar: Innerhalb von drei Jahren konnte die Zahl der Seitenaufrufe verdoppelt werden, auf acht Millionen (Stand 2021).
Der Name Rosbalt markiert die regionale, nordwestliche Ansiedlung der Agentur, in Sankt Petersburg („balt“ steht für die Ostseeregion), die damit weit weg vom Moskauer Nachrichtenbetrieb sitzt. Zumindest am Anfang, sagen Beobachter, wurde Rosbalt auch explizit als Sankt Petersburger Medium wahrgenommen.
Zum Profil gehören seit jeher profunde Wirtschaftsnachrichten und kritische Meinungsstücke zu Politik, Gesellschaft und Kultur. Ein „Lesemedium“ kann man es trotzdem nicht nennen. Die Eigenbezeichnung „Nachrichtenagentur“ trifft es gut. Gemeinsam mit den Büros in Moskau und Sankt Petersburg betreibt sie jeweils auch ein Pressezentrum.
Die Gründerin Natalja Tscherkessowa hatte sich in den 1990er Jahren als Chefredakteurin einen Namen bei Tschas Pik gemacht. Das war eine der ersten unabhängigen Zeitungen Sankt Petersburgs, die bis heute in der Branche geschätzt wird. Zwar ist ihr Ehemann Viktor Tscherkessow nicht direkt beteiligt, jedoch dürfte gerade sein Hintergrund für Rosbalts Kontakte entscheidend sein. Er leitete einst die oberste Drogenaufsicht, soll dann jedoch beim Kreml in Ungnade gefallen sein. Da er nach diesem Amt Dumaabgordneter der kommunistischen KPRF gewesen ist, wird Rosbalt bis heute nicht selten nachgesagt, eine Art Parteiblatt zu sein.
Zu einer schweren Krise für Natalja Tscherkessowa und ihre Agentur kam es im Jahr 2013, als zwei Verwarnungen der Medienaufsicht fast das Aus für Rosbalt brachten. Einfallstor waren zwei Videos, darunter von Aktivisten aus dem Umfeld von Pussy Riot. Der Vorwurf: Verwendung obszöner Vulgärsprache – obwohl es sich um verlinkte Inhalte handelte. Kurz darauf, nur ein paar Tage später, gab es eine Attacke auf Tscherkessowas Wagen, bei der ihr Fahrer verletzt wurde. Die bereits angeordnete Schließung schmetterte das Oberste Gericht im März 2014 schließlich doch noch ab.
Trotz der unterstellten Nähe zum Staatsapparat (wahlweise KPRF) galt Rosbalt immer als Teil der unabhängigen (Netz-)Öffentlichkeit in Russland.
Text: Mandy Ganske-Zapf
Stand: Oktober 2021
Eckdaten:
Gegründet: 2001
Generaldirektorin: Natalja Tscherkessowa
Chefredakteur: Nikolaj Uljanow
URL: www.rosbalt.ru
Teil des Dossiers „Alles Propaganda? Russlands Medienlandschaft“, gefördert von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius