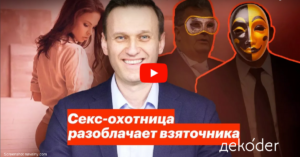Quelle
Republic
Republic ist im russischen Internet zu einem bedeutenden politischen Nachrichtenmagazin herangewachsen. Waren die Anfänge als reines Netzmedium noch ein Experimentierfeld für bekannte, enthusiastische Autoren, ist die Linie seit Mitte der 2010er Jahre klar: Die Währung sind seriöse Analysen und Kolumnen, gemäßigt oppositionell und meinungsstark. Wie viele weitere unabhängige Medien wurde Republic im Herbst 2021 auf die Liste der sogenannten „ausländischen Agenten“ gesetzt.
Auf Republic werden aus harten Fakten kommentierende Analysen generiert, die an aktuelle Diskussionen aus Politik und Wirtschaft anknüpfen, Ereignisse einordnen und deuten. Das ist der Markenkern, der über Jahre immer weiter herausgearbeitet wurde. Die stärkste Zäsur, um dahin zu kommen, hatte der frühere Chefredakteur Maxim Kaschulinski unternommen: Er begrub im Jahr 2016 den Gründungsnamen Slon (dt. Elefant). Seinerzeit ein radikaler Schritt, weil das Magazin unter diesem Titel sehr populär geworden war. Einen Website-Relaunch gab es obendrauf und so zeigt sich Republic bis heute in diesem Gewand.
Seither hat das Portal stetig neue Leser gewonnen, und zwar zahlende Abonnenten: meist internetaffine Städter auf der Suche nach unabhängigem Journalismus. Als seriöses Nachrichtenangebot, im Ton kremlkritisch und gemäßigt oppositionell, gehört es wie der unabhängige Internetsender Doshd zur Medienholding von Natalia Sindeeva und ihrem Ehemann, dem Unternehmer Alexander Vinokurov.
In der durch repressive Gesetze immer stärker bedrängten Nische der unabhängigen Medien sind Abonnenten eine wichtige Finanzierungsbasis. Waren es nach Angaben von Republic im April 2018 noch rund 22.000, hatte sich ihre Zahl mit mehr als 45.000 allein bis 20201 mehr als verdoppelt.
Noch wichtiger sind sie geworden, seit Republic im Herbst 2021 als „ausländischer Agent“ eingestuft wurde. Spätestens jetzt, mit dem Stempel „Agent“ wären Werbekunden ohnehin abgeschreckt. Das zeigt die Erfahrung anderer, schon zuvor gebrandmarkter Medien im Land. Dabei, das betonte Chefredakteur Dimitri Kolesew in einer Hausmitteilung2, mache Republic gar keine Werbung, und nehme keine Sponsoren- oder Fördergelder an, schon gar nicht aus dem Ausland. „Wir wissen nicht, auf welcher Grundlage und aus welchem Anlass das Justizministerium diese Entscheidung getroffen hat.“ Es werde schlicht versucht, schrieb Kolesew weiter, die unabhängigen Medien im Land zu zerstören.
Wer hinter Republics Paywall schaut, liest regelmäßig kritische Kommentare und Analysen namhafter Autoren. Von renommierten politischen Experten und Wissenschaftlern wie Tatjana Stanowaja und Wladimir Frolow, ebenso wie von erfahrenen Journalisten wie Oleg Kaschin, Andrej Sinizyn und Iwan Dawydow. Auffällig: Reine Nachrichten laufen nicht in Dauerschleife, sondern als handverlesene News, zum Beispiel in Form von Newslettern. Bereichert wird dieses Rezept um Interviews, Podcasts und Betrachtungen zu Themen von Technologie bis Literatur und Kultur.
Republic hat aus diesen starken Stimmen eine Magazinstruktur entwickelt, bei der sich sehr eigenständige Ressorts auf einem gemeinsamen Portal präsentieren. Dawydow etwa leitet das Ressort Wlast (dt. Staatsführung) und Sinizyn das Meinungs- und Politikressort. Dawydow ist außerdem stellvertretender Chefredakteur beim unabhängigen Magazin The New Times, Sinizyn war lange beim Moskauer Wirtschaftsblatt Vedomosti, das nach Besitzerwechsel aber an Unabhängigkeit eingebüßt hat.
Es war auch ein früherer Vedomosti-Mann, der Slon ursprünglich gegründet hat: Leonid Berschidski. Berschidski brachte Erfahrung aus US-amerikanischen sowie russischen Redaktionen mit und profilierte sich als gewiefter Manager für den Markteintritt. Mit Slon verfolgte er ursprünglich das Ziel, online den Wirtschaftsjournalismus gegen große Printmarken stark zu machen. Dafür holte er Profis ins Netz, darunter Olga Romanowa, damals eine der profiliertesten Journalistinnen des Landes, die vor allem in den 1990er Jahren durch ihre Sendung im damals noch unabhängigen Sender NTW bekannt geworden war. Beide sind heute nicht mehr am Projekt beteiligt. Berschidski wandte sich nach der Krim-Annexion 2014 von Russland ab, ging nach Berlin, nannte den Entschluss „Emigration aus Enttäuschung“3. Auch Olga Romanowa lebt mittlerweile in Berlin, wählte das Exil im Jahr 2017, nachdem sie sich mit ihrer NGO, einer Gefangenenhilfsorganisation, in ihrem Land unter Druck gesetzt sah.
Es war noch Berschidski, der die Weichen für den Erfolg gestellt hat. Schon 2010 entschied er, Nachrichtenartikel runterzufahren und als Geschäftsmodell stattdessen stärker bloggen zu lassen. Damals kündigten Teile der Redaktion unter großem Protest die Zusammenarbeit auf. Doch die spitze Feder sollte sich als eine Spezialität bei Slon erweisen – die Republic bis heute prägt.
UPDATE: Republic hat in einer Hausmitteilung angekündigt, einen Teil des bisherigen Materials zum Krieg in der Ukraine zu löschen oder zu ändern – benutzt dabei aber den von der russischen Föhrung vorgeschriebenen Begriff „militärische Spezialoperation“. Außerdem werde in Zukunft nur noch mit vorsichtiger Sprache über die Vorgänge in der Ukraine berichtet. Der Grund, teilt Republic mit, ist ein neues Gesetz, das am 4. März 2022 in Kraft getreten ist, das das „Verbreiten von Falschinformationen“ unter Strafe stellt. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. Seit dem 6. März ist die Seite, schreibt die Replubic-Redaktion zwei Tage später auf Telegram, außerdem für russische Nutzer gesperrt.
Text: Mandy Ganske-Zapf
Stand: 12.03.2022
Eckdaten
Gegründet: 2009
Chefredakteur: Dimitri Kolesew
Inhaber: Medienholding Doshd von Natalia Sindeeva und Alexander Vinokurov
URL: www.republic.ru (zuvor: www.slon.ru)
Teil des Dossiers „Alles Propaganda? Russlands Medienlandschaft“, gefördert von der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius1.Znak: Glavnym redaktorom Republic naznačen Dmitrij Kolezev ↑2.Republic: Minjust vnes Republic v reestr inostrannych agentov: Čto teper' budet? ↑3.Echo Moskvy: Leonid Beršidskij: Ėmigracija razočarovanija ↑