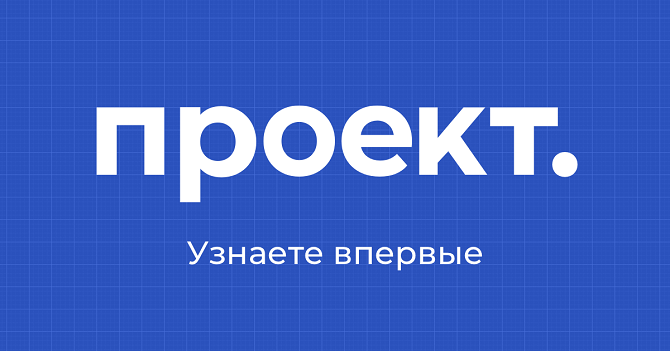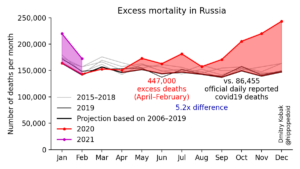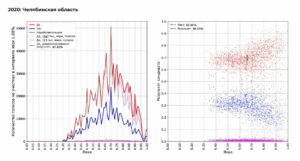Quelle
Projekt
Projekt ist ein gemeinnütziges Onlineportal, das dem Investigativjournalismus verpflichtet ist. Gründer ist Roman Badanin, ehemaliger Chefredakteur von RBC. Die Auflösung der dreiköpfigen RBC-Chefredaktion hatte 2016 für viel Aufruhr gesorgt, Beobachter sahen darin einen Angriff auf den unabhängigen und kritischen Journalismus in Russland.
Darauf reagiert Badanins Projekt: Es ging im Juli 2018 online und möchte seinen Lesern „die verborgenen und wichtigen Dinge“ darlegen – „weil es in Russland fast keine Medien mehr gibt, die sich mit komplexen und gefährlichen Themen beschäftigen“. Projekt hat sich dabei vor allem auf Recherchen und Reportagen spezialisiert.
Das gemeinnützige Medium, das Badanin nach einem einjährigen USA-Aufenthalt ins Leben rief, finanziert sich über in- und ausländische Förderer. Wobei Badanin weder Namen noch die genauen Summen nennt. Im Gespräch mit Vedomosti sagte er, dass Projekt zehn Mitarbeiter und ein Budget von 500.000 Dollar habe.
Mitte Juli 2021 hat das russische Justizministerium Badanin und vier weitere Projekt-Mitarbeiter zu „ausländischen Agenten“ erklärt. Das Medium selbst wurde in die Liste „unerwünschter Organisationen“ aufgenommen. Damit muss Projekt umgehend jegliche Geschäftstätigkeit in und mit Russland einstellen. Bei Zuwiderhandlung sieht das Ordnungs- und Strafrecht hohe Geld- und Freiheitsstrafen von bis zu sechs Jahren vor.
„Eine gebührendere Würdigung kann man sich kaum vorstellen", kommentierte Roman Badanin. Er sagte, dass das Medium weiterwirken werde und kündigte bereits die nächste politisch schwerwiegende Veröffentlichung an.
ECKDATEN
Gegründet: 2018
Gründer und Chefredakteur: Roman Badanin
URL: www.proekt.media