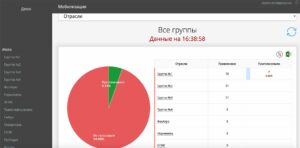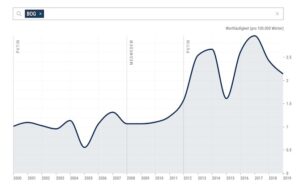Quelle
Meduza
Meduza ist ein Internetportal mit Hauptsitz in Riga (Lettland). Im April 2021 haben die russischen Behörden erklärt, das Online-Medium in die Liste der sogenannten „ausländischen Agenten“ aufzunehmen. Meduza wurde im Oktober 2014 von Galina Timtschenko gegründet, die zuvor langjährige Chefredakteurin von Lenta.ru war (2004-2014).
Lenta.ru galt als äußerst zuverlässige Nachrichtenquelle und war eine der meistzitierten journalistischen Ressourcen im russischen Internet. Timtschenko wurde im März 2014 entlassen. Zuvor hatte die Medienaufsichtsbehörde Lenta.ru wegen der „Verbreitung extremistischen Materials“ verwarnt. Hintergrund war ein Interview mit einem der Führer des ukrainischen Rechten Sektors. Mit Timtschenko verließ das ganze Team geschlossen das alte Projekt, und konstituierte sich neu in Riga als Meduza.
Meduza war zünachst vor allem ein Medien-Aggregator, der die wichtigsten Meldungen und Reportagen von anderen russischsprachigen Ressourcen sammelte. Inzwischen werden aber mehr und mehr eigene Artikel veröffentlicht. Außerdem bietet das Portal in Form von „info-Kärtchen“ zunehmend auch allgemeine, nützliche Auskünfte zu aktuellen und teils auch kuriosen Fragen („Wieviel verbotene europäische Lebensmittel darf man als privater Reisender nach Russland einführen?“ „Kann eine Ente ertrinken?“). Meduza erschließt sich so vor allem ein junges, internet-affines Publikum. Ausgewählte Artikel werden seit Januar 2015 auch ins Englische übersetzt.
Im Oktober 2018 wurde Meduza in einen Missbrauchsskandal verwickelt. Dem Chefredakteur des Magazins, Iwan Kolpakow, wurde von der Ehefrau eines Redakteurs sexuelle Belästigung vorgeworfen. Der Vorwurf konnte nicht widerlegt werden: Kolpakow war zum potentiellen Zeitpunkt der Tat stark alkoholisiert gewesen, er konnte sich an den Vorfall nicht erinnern und schloss ihn wegen seiner Erinnerungslücken aber nicht aus. Er bat schriftlich um Entschuldigung und reichte seinen Rücktritt ein. Seine Nachfolgerin wurde Tatjana Ershowa, die bis dahin in der Geschäftsführung des Mediums tätig gewesen war. Im März 2019 gab Galina Timtschenko bekannt, dass sie entschieden habe, Kolpakow wieder als Chefredakteur einzusetzen. Leiter aller Ressorts seien mit der Personalentscheidung einverstanden, so Timtschenko. Auf die Vorwürfe sexueller Belästigung ging sie bei der Bekanntmachung nicht weiter ein.
Am 23. April 2021 wurde Meduza in die Liste der sogenannten „ausländischen Agenten“ aufgenommen. Die Redaktion muss damit ihre Veröffentlichungen mit einem entsprechenden Vermerk kennzeichnen und die Finanzen offenlegen. Bei Verstößen droht eine Geldstrafe und letztlich die Blockade. Dem Medium droht zudem ein massives Wegbrechen russischer Finanzierungsquellen. „Das ist eine langsame Erdrosselung“, sagtе Chefredakteur Iwan Kolpakow im Interview auf Doshd.
Seit dem 4. März 2022 berichtet Meduza davon, dass der Zugriff auf ihre Website – wie die von weiteren unabhängigen Medien – in Russland blockiert wird. Die russische Medienaufsicht Roskomnadsor spricht von einer „Zugriffsbeschränkung“ mit Verweis auf eine Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft vom 24. Februar 2022 – dem Tag als Putin der Ukraine den Krieg erklärt hat. Im Januar 2023 wurde Meduza zur „unerwünschten Organisation“ erklärt.
Eckdaten
Gegründet: 2014
Chefredakteur: Iwan Kolpakow
Herausgeberin: Galina Timtschenko
URL: www.meduza.io
(Stand 05.03.2022)