Auf in die Zukunft mit Lew Tolstoi!
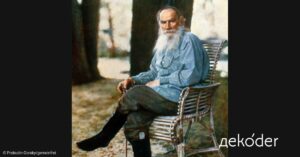
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Quelle
InLiberty ist der Nachfolger der 2005 vom Institute Cato gegründeten Webseite Cato.ru. Es wurde als Online-Ressource konzipiert, um die Ideen des Libertarismus Menschen im russischsprachigen Raum näherzubringen.
Unter dem heutigen Namen existiert das Projekt seit 2009 und dient als unabhängige Diskussionsplattform für Intellektuelle. Auf der Webseite äußern sie ihre Meinungen zu aktuellen Themen. In Vorträgen und Workshops, die regelmäßig stattfinden, setzen sie sich mit der Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Gesellschaft und des Individuums auseinander.
Manche Artikel werden in größeren Zeitungen nachgedruckt, sodass sie ein breiteres Publikum erreichen und nicht nur in elektronischer Form erhältlich sind. Die Redaktion mit Sitz in Moskau steht in Kontakt mit unabhängigen russischen Medien (u. a. Vedomosti, Kommersant) und führt mit ihnen gemeinsam Projekte und Veranstaltungen durch.
InLiberty stellt eine Online-Bibliothek mit ausgewählter klassischer und moderner Literatur zu unterschiedlichen Themen zur Verfügung, veröffentlicht Bücher und organisiert Essaywettbewerbe sowie Sommerschulen für Studenten aus postsowjetischen Ländern.
Eckdaten
Gegründet: 2009
Chefredakteur: Andrej Babizki
URL: www.inliberty.ru