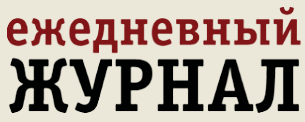Quelle
Ej
Das gesellschaftspolitische Online-Magazin Ezhednevnij Journal (Tägliche Zeitschrift) besteht seit 2004. Für das Portal schreiben liberal gesinnte Politologen, Analytiker, Wirtschaftsexperten sowie eigene Journalisten. 2014 wurde der Titel der Zeitschrift auf die beiden Buchstaben Ej gekürzt, so dass er nun, in russischer Schreibweise, dem Wort Igel entspricht. Der Vorgänger war ein Printmagazin mit gleichem Namen.
Im März 2014 wurde von der russischen Staatsanwaltschaft der Zugriff auf das Internetangebot ej.ru für eine unbestimmte Zeit wegen “öffentlicher Aufrufe zur Teilnahme an ungenehmigten Demonstrationen” gesperrt.1 Leser aus Russland können derzeit nur über ein Mirror-Site auf Ej zugreifen.
Eckdaten
Gegründet: 2004
Chefredakteure: Alexander Ryklin und Alexander Golz
Herausgeber: Olga Paschkova
URL: www.ej.ru
1: https://www.amnesty.de/urgent-action/ua-106-2014/protest-website-blockiert?