Muratows Krawatte und der Friedensnobelpreis
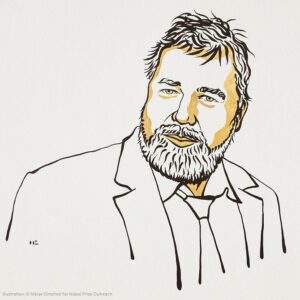
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Quelle
Carnegie.ru war die Online-Plattform des Moskauer Carnegie-Zentrums. Dieses war seinerseits Teil eines weltweiten Netzwerks von Think Tanks der Carnegie-Stiftung mit Sitz in Washington. Die Zweigstelle in Moskau wurde 1994 eröffnet. Nach eigenen Angaben sollte das Zentrum zur überparteilichen Diskussion wichtiger politischer und wirtschaftlicher Themen anregen und die Kooperation zwischen Russland und den USA fördern. Der Fokus lag dabei auf internationaler Politik. Seit 2008 wurde das Zentrum von dem Wissenschaftler und ehemaligen Militär-Offizier Dimitri Trenin geleitet.
Carnegie.ru veröffentlichte analytische Artikel sowohl von Mitgliedern des Carnegie-Netzwerkes als auch von externen Wissenschaftlern und Journalisten, die die politische und wirtschaftliche Situation in Russland aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Zu Wort kamen Experten, die sehr unterschiedliche Ansichten auf die Innen- wie Außenpolitik Russlands vertreten, zum Beispiel der Journalist und ehemalige Diplomat des russischen Außenministeriums Alexander Baunow (der seit 2015 auch Chefredakteur des Mediums ist), der Carnegie-Analyst und Kremlkritiker Andrej W. Kolesnikow oder der politische Publizist Fjodor Lukjanow, der außenpolitisch eine eher kremlnahe Position einnimmt.
Am 8. April 2022 stellte das Moskauer Carnegie-Zentrum seinen Betrieb ein, die Seite Carnegie.ru fungiert seitdem nur noch als Archiv. Dem vorausgegangen war eine entsprechende Verfügung des russischen Justizministeriums im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und damit einhergehenden Schließungen unabhängiger Medien in Russland. Beiträge von ehemaligen Carnegie.ru-Autoren erscheinen seitdem auf der russischsprachigen Website des Carnegie-Think Tanks.
Eckdaten:
Gegründet: 1994; eingestellt 2022
Chefredakteur: Alexander Baunow
URL: https://carnegie.ru