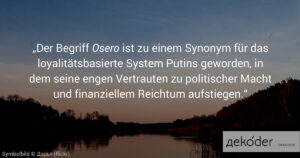Wlast – Russlands Machteliten
Das „anarchischste“, ja das „staatsloseste Volk“ überhaupt seien die Russen, schrieb der Philosoph Nikolaj Berdjajew Anfang des 20. Jahrhunderts. Es sei aber zugleich auch ein Volk, das sich willig dem Bürokratieapparat unterwerfe und eine sehr „mächtige Staatlichkeit“ schaffe, fügte er hinzu.
Glaubt man manchen russischen Kulturologen, so hat sich an diesem Widerspruch seit Berdjajews Zeit kaum etwas verändert. 31 Prozent der russischen Bürger glauben heute, dass die Staatsmacht kriminell sei, elf Prozent stufen sie gar als parasitär ein, so die Lewada-Umfrageergebnisse aus dem Jahr 2016.
Wie geht es aber zusammen, dass über 80 Prozent der Menschen in Russland Zustimmung für den Präsidenten äußern und zugleich nur sechs Prozent meinen, dass die Staatsmacht gerecht sei?
Die Lösung des Rätsels liegt im aufgeladenen und widersprüchlichen Phänomen namens Wlast. Dieser Begriff kann sowohl den Macht- und Herrschaftsbegriff umfassen, als auch die Staatsmacht, Regierung, Behörden, Oligarchen oder auch irgendeine Obrigkeit – mit entsprechenden Schwierigkeiten bei der Übersetzung in andere Sprachen. Je nach Interpretation kann Wlast außerdem ganz andere Bedeutungsinhalte haben: Von der personifizierten Staatsmacht Putins, über die Anonymität und Unsichtbarkeit der Macht, wie man es etwa bei Kafka kennt, bis hin zum Orwellschen Unterdrückungsapparat.
Das dekoder-Dossier ist eine Annäherung an das Phänomen Wlast: Inwieweit kann man Wlast mit Putin gleichsetzen? Ist Wlast in Russland denn wirklich absolut und unteilbar, wie es ein gängiges Klischee suggeriert? Was hat sie mit der gesellschaftlichen Ordnung und mit ihrer Konstruktion zu tun? Und was bedeutet das Ganze konkret für die russische Innen- und Außenpolitik? Für das Verhältnis zur EU und zu den USA? Diese Fragen stellen sich vor allem auch angesichts der Präsidentschaftswahl im März 2018.
Zum dekoder Newsletter anmelden
Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.
Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.