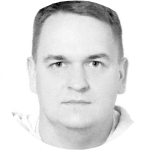Platforma: (Exil-)Journalisten schreiben für dekoder
In diesem Dossier sammeln wir Texte aus unserer Reihe Platforma, in der wir russische, belarussische oder auch ukrainische Journalistinnen und Journalisten bitten, für uns zu schreiben und Einblick in aktuelle Debatten und Entwicklungen zu osteuropäischen Themen zu liefern.
Die Texte werden mitunter von Journalistinnen und Journalisten verfasst, die sich gezwungen sahen, aufgrund der Repressionen in ihren Ländern ins Exil zu gehen.
Zum dekoder Newsletter anmelden
Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.
Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.