Jüdisches Leben in Belarus bis 1917
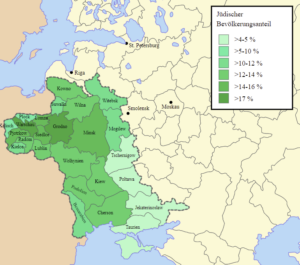
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
„Wir sehen eine Nation, die sich ihrer selbst bewusst wird“, schreibt der belarussische Ökonom Sergej Tschaly wenige Tage nach der Präsidentschaftswahl am 9. August 2020: Die offiziellen 80 Prozent für Amtsinhaber Lukaschenko bei einer immer deutlicher dokumentierten massiven Wahlfälschung, der exzessive Gewalteinsatz von Polizei und Sondereinheiten schon im Vorfeld der Wahl, der dann am 9. August und an den Tagen danach seinen blutigen Höhepunkt fand mit Blendgranaten und Schusswaffen gegen Demonstranten, die Verstorbenen, mehrere tausende Festgenommene, von denen viele später über beispiellose Gewalt, Erniedrigungen und Misshandlungen in den Gefängnissen berichteten – all das hat für viele Menschen in Belarus das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht und einen Wandel- und Selbstermächtigungsprozess in Gang gesetzt, dessen Ausgang immer noch unklar ist. Auch wenn dieser Prozess durch die anhaltenden Repressionen vorerst gestoppt wurde bzw. ins Ausland verlagert wurde, wo eine neue belarussische Diaspora sich darum bemüht, die 2020 entstandene Demokratiebewegung weiterzuentwickeln.
Was es mit der allgegenwärtigen weiß-rot-weißen Fahne auf sich hat, wieso die Frauen bei dem Protest eine so eine wichtige Rolle spielten, welche Rolle Alexander Lukaschenko und Belarus beim Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine spielen – hier bündeln wir alle dekoder-Materialien zu den schon jetzt historischen Ereignissen in Belarus, die wir seit 1. November 2020 mit einem eigenen Belarus-dekoder verstärkt begleiten.
Am 1. April 2021 startete unser Projekt Peremen – Belarus im Wandel, mit dem dekoder nicht nur den gesellschaftspolitischen Wandlungsprozess in dem immer noch unbekannten osteuropäischen Land journalistisch darstellt und aufbereitet, sondern auch differenzierte Beiträge mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zu diesem faszinierenden Kulturraum bietet. Auf diesem Projekt baute seit dem 1. April 2022 die Erweiterung Perspektiven für Belarus auf. Zusätzlich zu den journalistischen und wissenschaftlichen Beiträgen, die wir weiterhin zu Belarus liefern, bieten wir in der Reihe „Exiljournalismus“ Beiträge von russischen, belarussischen oder auch ukrainischen Journalistinnen und Journalisten. Sie schreiben über aktuelle Debatten und Entwicklungen zu osteuropäischen Themen. Die Texte werden weitgehend von Journalistinnen und Journalisten geschrieben, die sich gezwungen sahen, aufgrund der Repressionen in ihren Ländern ins Exil zu gehen. Darauf folgte ab 1. April 2023 unser Projekt unter dem Titel Belarus sichtbar machen. Am 1. April 2024 haben wir mit dem Projekt Belarus: Kampf um die Zukunft begonnen. Denn darum geht es in dieser weiterhin erschütternden Zeit: differenziertes und vertieftes Wissen zu Belarus zugänglich zu machen, ein besseres Verständnis für diesen lange vernachlässigten Kulturraum und weiterhin auch für die Lebensweiten der Berlarussen in ihren neuen Exilländern und in Belarus selbst zu ermöglichen.
Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.
Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.