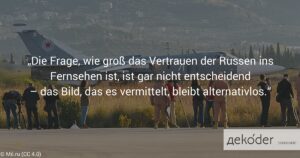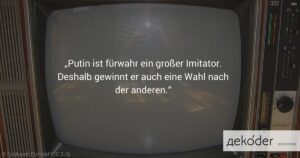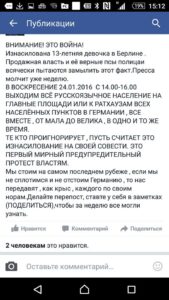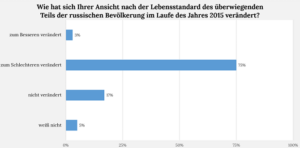Alles Propaganda? Russlands Medienlandschaft
Wie frei sind Medien in Russland?
In diesem Dossier sammelt dekoder Hintergrundartikel, Analysen und Interviews zu Fragen wie diesen:
Welche Rolle spielt das Fernsehen in Russlands Medienlandschaft?
Und welches Bild wird darin vermittelt?
Wer sind die Personen, die im russischen Staatsfernsehen als „Experten“ auftreten?
Triumphiert am Ende Propaganda über Journalismus?
Einige Artikel, Gnosen und Presseschauen widmen sich außerdem den letzten verbliebenen unabhängigen Medien in Russland, aus denen dekoder immer wieder übersetzt. Es gibt sie – doch ihre Freiräume wurden in den vergangenen Jahren immer kleiner. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine hat sich ihre Lage zudem dramatisch verschärft: Die Redaktionen sowie die Journalistinnen und Journalisten, die für sie arbeiten, sind in Gefahr.
Mehr dazu in unserem Dossier: Zensierte Medien – Journalisten in Gefahr.
Zum dekoder Newsletter anmelden
Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.
Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.