Muratows Krawatte und der Friedensnobelpreis
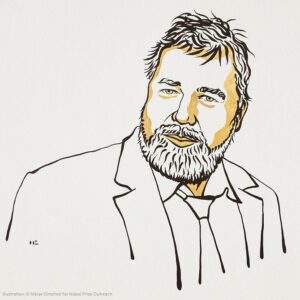
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Die Beziehung zwischen der EU und Russland ist schon seit Jahren belastet, seit Anfang 2021 sprechen europäische Politiker wie Josep Borrell und Heiko Maas aber vermehrt von einem „Tiefpunkt“. Schon nach der Krim-Angliederung, dem MH17-Abschuss, den Hackerattacken auf den Bundestag, den Kriegen in der Ostukraine und Syrien geriet der deutsch-russische Dialog immer wieder auf den Prüfstand. Die Vergiftung und die Verurteilung von Alexej Nawalny markieren laut vielen Beobachtern aber eine entscheidende Zäsur in den deutsch-russischen Beziehungen.
Ein politischer Dialog scheint immer schwieriger. Dabei sind die (zwischen-)gesellschaftlichen Wertediskurse in Russland und Deutschland eng miteinander verzahnt: Sie bedingen sich teilweise gegenseitig, werden aber auch nicht selten diametral oder parallel geführt, mit vielen blinden Flecken über den Diskurs in der jeweils anderen Gesellschaft.
Solche blinden Flecken will dieses zweisprachige Dossier beheben. In Text, Bild und Ton kommen hier russische wie deutsche Journalisten und Wissenschaftler zu Wort.
Mit der Anmeldung, bestätigst du, dass die von dir angegebenen Informationen an MailChimp (unsere Plattform zur Marketing-Automatisierung) zur Verarbeitung in Übereinstimmung mit deren Datenschutzrichtlinien und Bedingungen weitergegeben werden.
Du kannst deine Meinung jederzeit ändern, indem du auf den Abbestellungs-Link klickst, den du in der Fußzeile jeder E-Mail, die du von uns erhältst, finden kannst, oder indem du uns unter info@dekoder.org kontaktierst.