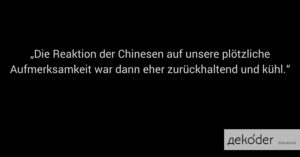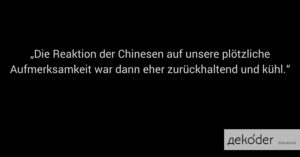Kommersant
Der Import von Käse ist gestoppt, Käse wird nun vermehrt im Inland hergestellt. Parmesankäse, Cheddarkäse, Mozzarella und andere beliebte Käse werden munter kopiert – die Käseproduzenten jubilieren. Doch was als Käse im Regal steht, ist nicht alles Käse.
In Wirtschaft by Ilja Daschkowski