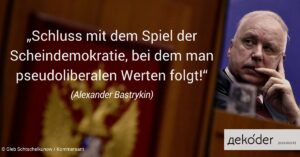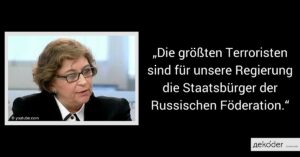Kategorie
Politik
-
-
Die kurze Geschichte der Demokratischen Koalition

-
Presseschau № 30: RBC – Medium unter Druck
-
Unterschiedliche Frequenzen

-
Die Kreml-Liberalen
-
Presseschau № 27

-
„Zeit, dem Informationskrieg einen Riegel vorzuschieben“

-
Presseschau № 26

-
„Die Rhetorik derzeit ist komplett putinozentrisch“

-
Presseschau № 25