Geschäfte und Geopolitik in Afrika
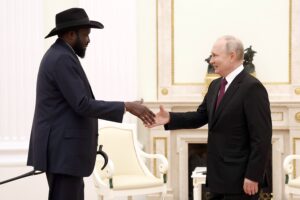
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Autor:in
Wladislaw Inosemzew (*1968) ist Wirtschaftswissenschaftler und Publizist. Ausgebildet an der renommierten Moskauer Lomonossow-Universität, war er unter anderem bis 2003 im Vorstand der Moskau-Pariser Bank tätig. Er betätigte sich ab 2010 in der politischen Opposition bei der Partei Prawoje delo (dt. Die Rechte Sache), ist aber auch Mitglied mehrerer offizieller Beratungsorgane – etwa dem Russischen Rat für Internationale Beziehungen. Inosemzew schreibt regelmäßig für Zeitungen und Internetmagazine, u. a. Vedomosti, Slon, The New Times und RBC.