Kein Tag der Einheit: der 17. September 1939
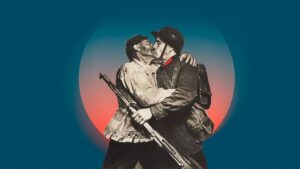
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Autor:in
Viktor Schadurski ist ein belarussischer Historiker. 1984 schloss er sein Studium der Geschichte an der Belarussischen Staatlichen Universität (BGU) ab, es folgten Promotion und Habilitation. Von September 2008 bis März 2021 war er als Dekan und Professor am Institut für internationale Beziehungen an der BGU tätig. Im März 2021 wurde er wegen seiner staatsbürgerlichen Haltung von der Universität suspendiert. Seit April 2022 arbeitet er gemeinsam mit dem Historiker Thomas M. Bohn der Justus-Liebig-Universität in Gießen an dem Projekt: „Republik Belarus: von der parlamentarischen Demokratie zum autoritären Regime (1990 bis 1996)“, das von der Gerda-Henkel-Stiftung finanziell unterstützt wird. Er hat über 200 wissenschaftliche Publikationen verfasst.