Häusliche Gewalt in Russland
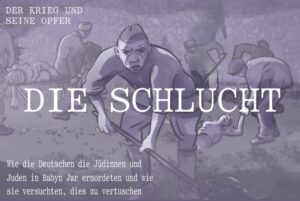
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Autor:in
Regina Elsner ist Theologin und seit September 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS). Sie studierte katholische Theologie und arbeitete als Projektkoordinatorin für die Caritas Russland in St. Petersburg. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ökumenischen Institut der Universität Münster befasste sie sich mit den historischen und theologischen Aspekten der Auseinandersetzung der Russischen Orthodoxen Kirche mit der Moderne und schloss 2016 ihre Promotion zu diesem Thema ab. Am ZOiS untersucht Regina Elsner mit dem Projekt Moral statt Frieden die Dynamiken der russisch-orthodoxen Sozialethik seit dem Ende der Sowjetunion.Foto © Annette Riedl