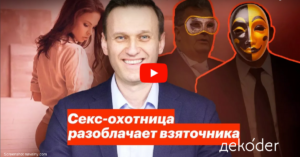Autor:in
Oleg Kaschin
Oleg Kaschin (geb. 1980) ist ein bekannter russischer Journalist. Er schreibt für verschiedene unabhängige Medien und gibt sich in seinen Artikeln betont kremlkritisch. Mutmaßlich wegen dieser Haltung wurde er bereits mehrmals Opfer von Gewalttaten. So schlugen ihn 2010 drei Menschen brutal zusammen, Kaschin musste sich einigen Operationen unterziehen. 2015 gab der Journalist bekannt, dass Indizien gegen drei Täter vorliegen würden. Ein von ihm angestrebtes Gerichtsverfahren wegen versuchten Mordes wurde allerdings noch nicht eröffnet.