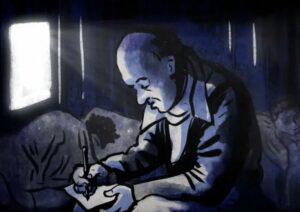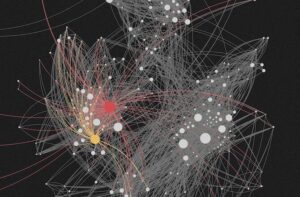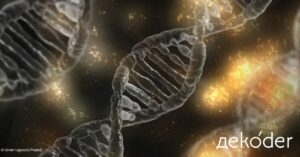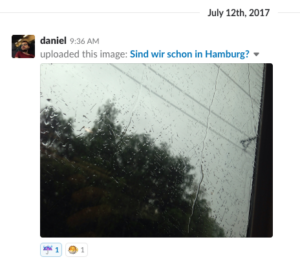IM HEIM DES KRIEGES

Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Autor:in
Leonid A. Klimov studierte Kultur- und Literaturwissenschaften in St. Petersburg, promovierte zum Kandidat Nauk und schloss danach ein zusätzliches Masterstudium des Kultur- und Medienmanagements in Hamburg an. Er ist Wissenschaftsredakteur von dekoder und koordiniert die Arbeit der akademischen Experten in den Bereichen Geschichte und Kultur.