Das Lenin-Mausoleum
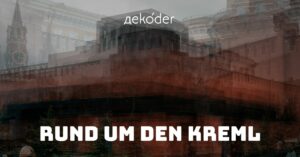
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Autor:in
Ekaterina Makhotina ist promovierte Osteuropahistorikerin. Sie forscht an der Universität Bonn unter anderem zu Erinnerung und Geschichtspolitik in Russland und im östlichen Europa.