Diktaturen der Angst
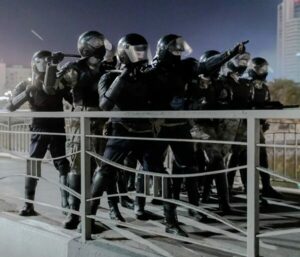
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung
Autor:in

Anton Himmelspach ist Sozial- und Politikwissenschaftler. Bei dekoder kuratiert er als Redakteur für Politikwissenschaft die Arbeit der externen akademischen Experten und verfasst Sachtexte und Begriffserklärungen.