Julia Artjomowa, 1985 geboren, hat sich in Belarus als Autorin einen Namen gemacht. In ihrem 2021 erschienenen Roman Ja i jest rewoljuzija (dt. Ich bin die Revolution) erzählt sie „eine sehr aufrichtige, sehr weibliche und sehr verruchte Geschichte: über Revolution und Liebe, über Brüderlichkeit und Schwesternschaft, über den Zerfall von Illusionen und das Erwachsenwerden als Wahl“. In ihrem Essay für unser Projekt Spurensuche in der Zukunft, der im Titel sarkastisch auf das von Alexander Lukaschenko verkündete Jahr des historischen Gedenkens anspielt, reflektiert Julia Artjomowa (die mittlerweile in der Ukraine lebt) die Gewalteskalation, die sich im Zuge der historischen Proteste 2020 in ihrer Heimat und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in ihrer Region eingestellt hat. Und sie fragt sich, ob man mit dem Wissen um diese schreckliche Gewalt überhaupt noch an diese Orte zurückkehren kann.
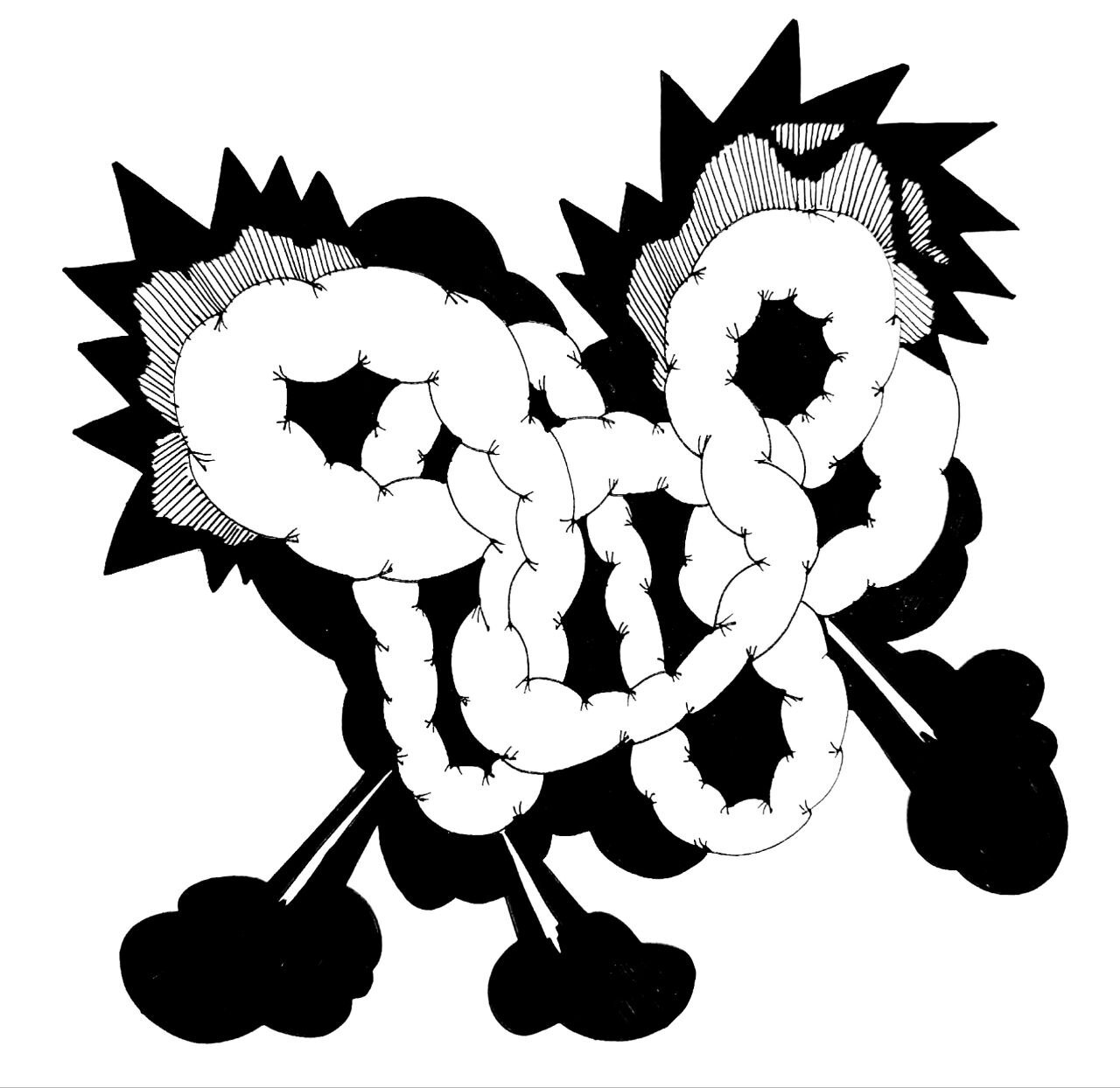
Diesen Text kann ich nur in der ersten Person schreiben. Normalerweise würde ich ihn niemandem zeigen – Tagebucheinträge sind nicht für fremde Augen bestimmt, und das hier ist fast einer. Aber wir haben (kein) Glück – wir leben in einer Zeit und an einem Ort, wo unsere Erinnerungen zu Tagebüchern werden und unsere Tagebücher zu Dokumenten. Unsere Balkone und Fenster werden zu Tribünen, unsere Körper zu Zeugen und Beweisen von Verbrechen. Die Buchstaben presst du mühevoll aus dir heraus, weil es dir wie so vielen die Sprache verschlägt, deine Stimme ist heiser, aber immer noch da, und deswegen muss sie erklingen, ja, muss. Daher kann ich diesen Text schlichtweg nicht nicht veröffentlichen.
Ich glaube, es war im Februar 2021. Wirklich, im Februar? War es nicht Januar? Oder doch März? Vielleicht schon im Dezember? Ich weiß noch genau, dass es geschneit hat – doch das ist ein zweifelhafter Anhaltspunkt. Herrscht in Belarus in diesen Monaten nicht fast immer unerträglich graues, matschiges Schneewetter? Oder hat sich in diesen Tagen einfach alles verknäuelt, verklumpt, verklebt, wie ein Schneeball, zu einem einzigen langen Monat des Wartens? Aber für das hier sind Chronologie und dokumentarische Genauigkeit überhaupt nicht wichtig. Also, sagen wir Februar. Im Februar 2021 trieb ich mich abends in der Stadt herum und machte ein paar Besorgungen. Auf dem Heimweg wollte ich Geld abheben. Ich suchte in der App den nächsten Geldautomaten und machte mich auf.
Auf halbem Weg erwischte es mich. Eine Druckwelle versetzte mich zurück in die jüngste Vergangenheit. Ein halbes Jahr zuvor hatten mein Freund Kolja und ich uns öfter genau bei diesem Geldautomaten getroffen. Das war einfach ein praktischer und eindeutiger Treffpunkt. Am Samstag, den 15. August, um 12 Uhr waren wir von hier aus zusammen zur Beerdigung von Alexander Taraikowski gegangen.
Damals, an jenem Februarabend im Schnee, begriff ich, dass es die Stadt meiner Kindheit, die Stadt, in der ich den Großteil meines Lebens verbracht hatte, nicht mehr gibt. In Minsk gibt es keine Geschäfte mehr, keine Läden, keine Höfe, Zäune, Cafés. Minsk ist überzogen mit einem Netz aus Narben: Da drüben sind wir davongerannt – und dorthin entkommen; da haben wir uns in der Hauseinfahrt versteckt; da haben wir gestanden und gesehen, wie sie auf die Menschen einprügeln und sie auseinandertreiben, und waren selbst erstarrt; da eine Spur von einer Blendgranate; da marschierten die Frauen durch; da wurde mein Mann Shenja geschnappt, und jedes Mal – wirklich jedes Mal – wenn wir an dieser Stelle vorbeifuhren, sagte er: „Da haben sie mich festgenommen“; dort waren im Winter die Hofproteste mit dem Nachbarbezirk; da standen wir in der Solidaritätskette, zusammen mit Roma und anderen Leuten aus unserem Hof. Und da, da wurde Roma umgebracht.
Ich schließe die Augen. Auf dem Stadtplan gibt es keine blinden Flecken mehr, keine sauberen Stellen, keine Erinnerungen mehr an das vorrevolutionäre Leben. Erstaunlich, wie das Gedächtnis funktioniert – es legt sich in Schichten übereinander wie Wandverputz. Und jede neue Schicht scheint die vorherige zu verwischen, zu überdecken, zu ersetzen.
Was ist auf der vorigen Schicht? Straßen, die ich als verliebte Sechzehnjährige entlangspazierte, mit immer derselben Kassette im Walkman. Den Park zehn Minuten von unserem Haus entfernt, in den meine Mutter immer mit mir ging, als ich klein war. Den Hof, wo meine beste Freundin und ich so gern saßen, uns am Karussell drehten und billigen Rotwein direkt aus der Flasche tranken, die wir uns teilten. Sogar die Schule, die ich neun Jahre lang besuchte, ist jetzt die, die an mein Wahllokal grenzt, und meine Lehrer sind zu Mitgliedern der Wahlkommission geworden, die ein gefälschtes Protokoll unterschrieben haben. Als hätte es mich als Sechzehnjährige nie gegeben. Das Private ist politisch. Mein Privates wurde in nur drei Tagen, 9. bis 11. August, mit einem groben Radiergummi aus dem Stadtplan gelöscht. Tage der Folter. Unser 9/11.
Wäre es doch nur die Stadt. Aber auch ganz normale Dinge bekamen plötzlich eine andere Bedeutung, einen anderen Sinn. Im August/September/Oktober 2020 waren wir ein riesiger Menschenfluss. Wie der kleine Fluss Nemiga, der einst in eine Betonröhre gezwängt wurde. Als unsere Demonstrationen endgültig von der Straße verdrängt waren, wurden gewöhnliche Bänke, Zäune, Bäume, Aufzüge und Haltestellen zu Plakaten, zu Leinwänden für politische Statements. Die Wände verlassener Häuser und normaler Plattenbauten fingen an zu weinen wie Ikonen: Nichts vergessen, nichts verzeihen. Diese Worte in roter Schrift drangen immer und immer wieder durch mehrere Schichten weißer Farbe. Als die Schichten zu viele wurden und die Buchstaben nicht mehr durch die Farbe schimmerten, wussten alle, was sich hinter den weißen Rechtecken verbarg.
***
Ein Junimorgen, Samstag, im Zentrum von Warschau. Meine Schulfreundin und ich sitzen auf der Terrasse eines Cafés (sie war immer einfach meine Schulfreundin gewesen, bis sie zu eben jener Freundin aus Irpin wurde, die mit ihrer Mutter und ihrer Katze zehn Tage unter Beschuss der Stadt überlebt hat). Hier in Warschau ist der Krieg überhaupt nicht spürbar, auch wenn überall viele ukrainische Flaggen hängen, sehr viele. Ich stelle meiner Freundin eine Frage, die mir schon lange im Kopf herumgeht: „Willst du zurück in die Ukraine?“ Sie sagt: „Weißt du, ich würde gern manchmal hinfahren, mal eine Woche oder zwei nach Lwiw oder Kyjiw, mal nach Odessa oder in die Karpaten. Aber richtig zurück … Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt in Irpin leben soll, wo in dem Park mit Designerbänken Menschen beerdigt wurden.“
Sie redet und redet, und ich höre ihr aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen, sie spricht, und ich merke mir, was sie sagt, sie spricht, und ich begreife – sie antwortet für uns beide, sie beantwortet auch meine eigene Frage, vor der ich jedes Mal wieder Angst habe, weil ich dann ehrlich mit mir selbst sein muss. Will ich zurück nach Minsk? Will ich jeden Tag vor meinem Fenster den Hof sehen, in dem mein Nachbar Roma erschlagen wurde? Will ich auf dem Spielplatz, der jetzt eine Gedenkstätte ist, Kaffee trinken? Will ich durch Straßen gehen, in denen Menschen geprügelt wurden, wo auf Menschen geschossen wurde, wo Granaten auf Menschen geschleudert wurden?
Es ist unmöglich, in einer Stadt leben zu wollen, in der Parks zu Massengräbern und Spielplätze zu Gedenkstätten werden.
So wird mir ein Jahr nach meiner Ausreise, während ich in der Warschauer Morgensonne sitze, endgültig bewusst – du kannst nicht zurück nach Minsk, diese Stadt gibt es nicht mehr, sie existiert nur in deinem Gedächtnis, sie besteht aus erinnerten Bildern wie Frankensteins Monster. Wir wollten sie umschreiben, aber haben es nicht geschafft. Jetzt ist sie nurmehr der Entwurf einer Stadt, der von einem unfähigen Schriftsteller mittendrin verworfen wurde.
Und trotzdem, und trotzdem ist es die Stadt, in deren Adern die Nemiga unseres Widerstands fließt. Wieder schlage ich mein Tagebuch auf und lese den Eintrag:
Letzten Sommer waren mein Mann und ich Fahrradfahren. Wir fuhren über die Stela auf den Siegerprospekt. Im Jahr davor hatte diese Gegend an Sonntagen ganz anders ausgesehen, und wir hatten so sehr gehofft, dass wir die Sieger sein würden. Jetzt überall rot-grüne Flaggen, demonstrativ viele, mehr als Menschen weit und breit. Und was für Menschen. Gleichgültige, die herumspazierten, als wäre nichts gewesen. Als hätten wir wirklich das nächste Kapitel aufgeschlagen. Es war bitter – vor einem Jahr noch war hier ein weiß-rot-weißer Fluss geflossen. Wir setzten uns auf eine Bank vor ein Gebäude mit dem Schriftzug: Minsk – Heldenstadt. Ich verschwand in meinem Handy, um mich abzulenken. Auf die nächste Bank setzte sich ein junger Vater mit seinem kleinen Sohn. Zufällig drang ihr Gespräch zu mir durch, es war nicht zu überhören – sie sprachen Belarussisch. Das war wie ein kleines Wunder. Als würde dir die Stadt in dem Moment, in dem du die Hoffnung verlierst, zuzwinkern.
Minsk gibt es nicht – es existiert nur in unserem kollektiven Gedächtnis.
Minsk gibt es – es existiert in unserem kollektiven Gedächtnis.
Und solange wir uns an alles erinnern, gibt es eine Chance. Eine Chance, die Stadt neu zusammenzusetzen, die Narben mit Tattoos zu verdecken, den Orten neuen Sinn zu verleihen. Hinaus auf die Straßen zu gehen und sich die Stadt zurückzuholen. Keine neue Seite aufzuschlagen, sondern diese sauber umzuschreiben, ins Reine. Dort Gedenkstätten zu errichten, wo der Schmerz wirklich groß war. Nicht zu vergessen und nicht zu verzeihen. Den Straßen neue Namen zu geben. Die Nemiga aus dem Rohr zu befreien.
***
Es gibt noch etwas, das unser kollektives Gedächtnis lange prägen wird. 2020 haben die Belarussen eine erstaunliche Kraft in sich entdeckt, aus der unsere Nationalidee entstand. Damals war niemand in der Lage, diese Kraft richtig zu benennen, keiner konnte diese Idee formulieren. Die unglaublichen Belarussen? Das klang zu begeistert und zu naiv.
Jetzt, wo unsere ukrainischen Nachbarn so hingebungsvoll für ihre Freiheit kämpfen und uns manchmal Schwäche und Feigheit vorwerfen, ist es besonders schwer, sich das nicht zu Herzen zu nehmen, sich nicht selbst zu geißeln und sich nicht zu schämen. Wir hören nicht auf zu vergleichen. Und immer schneiden wir schlecht ab bei diesem Vergleich.
Doch auch, wenn wir uns so ähnlich sind, so sind wir doch ganz verschieden. Während die Ukrainer sagen: „Kämpft, und ihr werdet gewinnen!“, sagen wir: „Wir werden nicht vergessen, nicht verzeihen.“ Und diese Worte scheinen mir die ehrlichste und treffendste Losung von allen zu sein, die aus unserer gescheiterten Revolution 2020 hervorgegangen sind. Diese Worte sprechen aus jedem verletzten Herz. Diese Worte stehen für 9/11 genauso wie für Taraikowski, Bondarenko, Schutow und Aschurak. Diese Worte stehen für Sawadski, Gontschar und Sacharenko. Für 1307 politische Gefangene. Für 30 Journalisten, die von Repressionen betroffen sind. Für 28 Jahre ohne Wahl. Für Dima Stachowski, den 17-jährigen Jungen, der wegen Teilnahme am Protest strafrechtlich verfolgt wurde und Selbstmord beging. Für Andrej Selzer. Diese Worte stehen für Hunderte von Raketen, die seit Februar von meinem Land aus auf die Ukraine abgefeuert werden. Sie stehen für Kuropaty. Die Worte stehen für Bykau, Karatkewitsch, Kupala und Kolas. Die Worte stehen für die Nacht der erschossenen Dichter.
Heute, da ich in der Ukraine bin, sehe ich jeden Tag, wie sogar auf dem unfruchtbarsten Boden Leben entsteht. Es bahnt sich seinen Weg durch Schmerz, Krieg und Horror. Ich weiß, das ist es, was mein Volk am besten kann, genau das ist die nationale Idee der Belarussen – nicht zu kämpfen, sondern wie Gras durch den Asphalt zu dringen, trotz des rauen, harten Winters. Zu wachsen, wo sonst nichts mehr wächst. Zu überleben, zu leben und zu gedenken, sich immer wieder zu erinnern. Nicht zu vergessen, nicht zu verzeihen.
… nicht zerschlagen, nicht stoppen, nicht aufhalten.