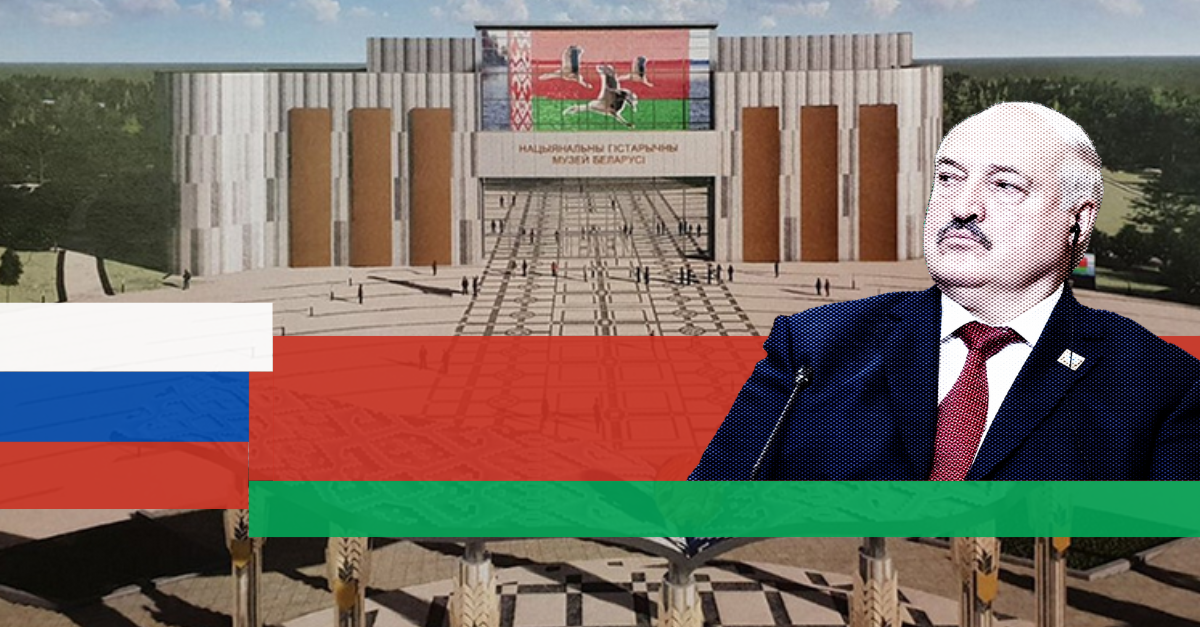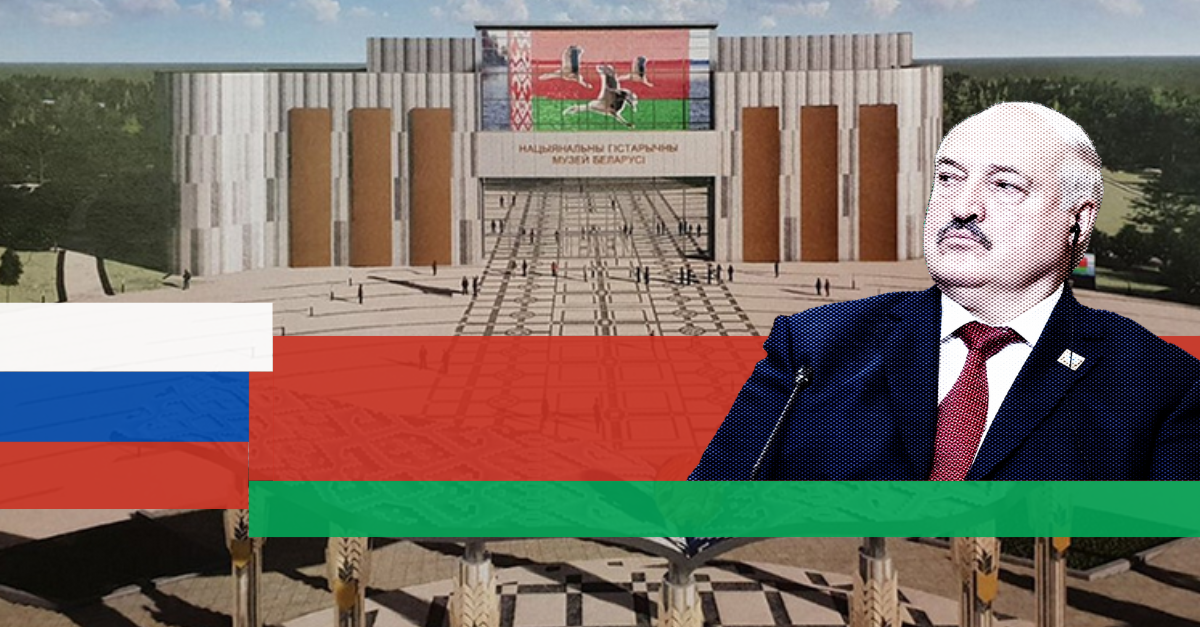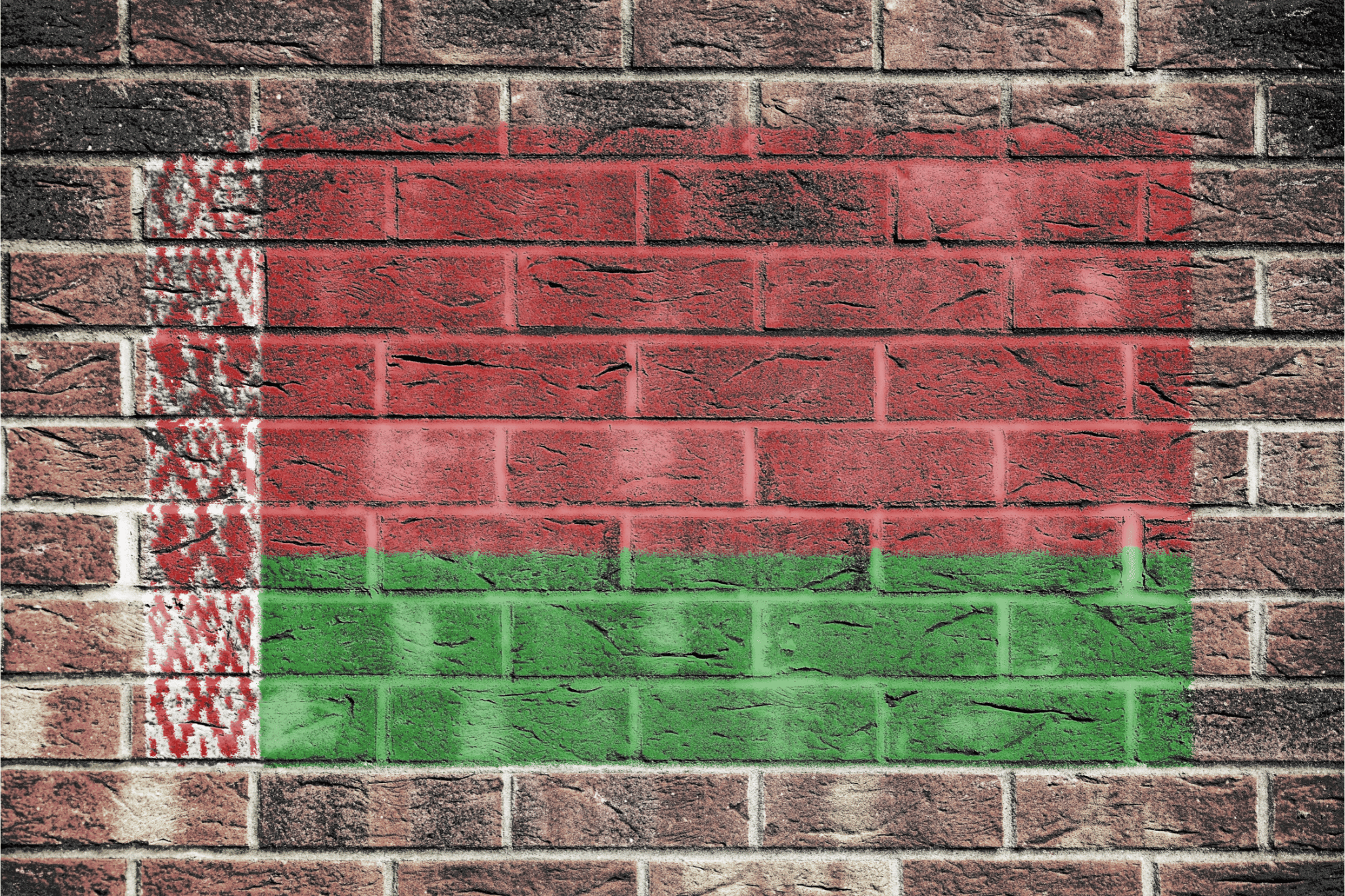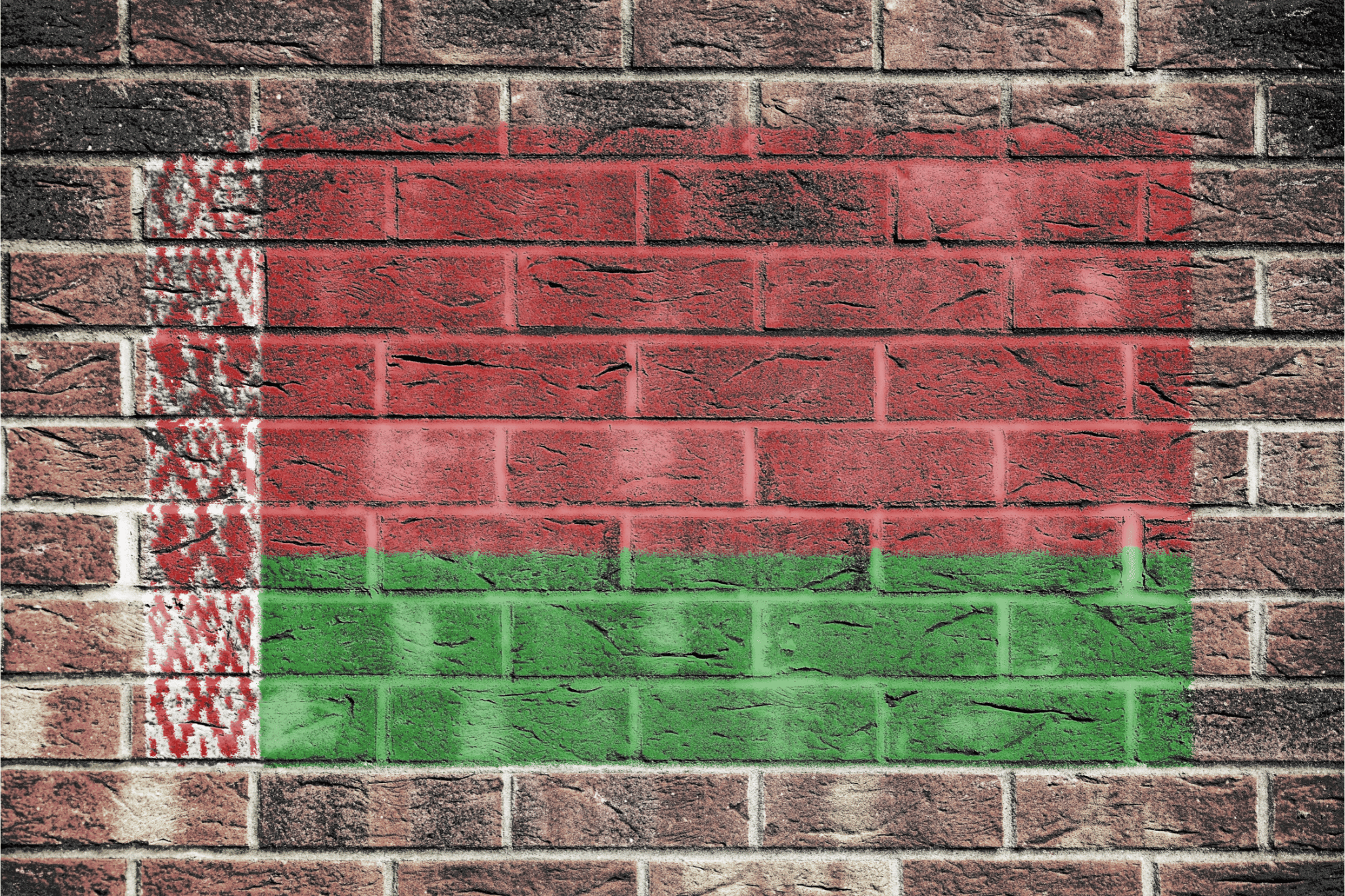Belarus spielt eine undurchsichtige Rolle bei der Verschleppung ukrainischer Kinder aus den von Russland besetzten Gebieten. Belarussische NGOs wie Nasch dom verfolgen schon länger, wie schon hunderte Kinder aus der Ukraine über Belarus letztlich nach Russland gebracht wurden.
Gleichzeitig holt Belarus immer wieder auch für kurze Zeit ukrainische Kinder aus den von Russland besetzten Gebieten zu sich ins Land: angeblich, um ihnen eine Auszeit vom Krieg zu ermöglichen. Diese ferienlagerartigen Projekte nutzen häufig die belarussischen Staatsmedien für ihre Propagandasendungen: Dann lassen sie die Kinder russische Propaganda nacherzählen und ideologische Phrasen aufsagen. Oft stellen die Moderatoren so lange Fragen zu Angriffen, Verletzungen und Todesfällen, bis die Kinder in Tränen ausbrechen.
Die ukrainische Menschenrechtsplattform Zmina hat diese Sendungen analysiert und fasst zusammen, wie die belarussischen Medien die ukrainischen Kinder dazu benutzen, russische Propaganda zu verbreiten.

Tränen, TV und Traumata
In belarussischen Medien gibt es immer wieder Berichte, in denen Kinder aus den (von Russland – dek) besetzten ukrainischen Gebieten ihre Erlebnisse aus dem Krieg erzählen und dabei weinen. Es kümmert die Propagandisten nicht, dass solche Aufnahmen Traumatisierung und Retraumatisierung auslösen können. Dabei erwähnen sie oft, dass die Kinder den Angriff, die Verletzungen oder den Tod der Angehörigen eigentlich vergessen wollen.
Ein Beispiel dafür ist der Bericht des staatlichen Senders ONT über „Kinder mit besonderem Schicksal, die zur Rehabilitation in Belarus sind“. In dem Video erzählt eine 11- bis 12-jährige Weronika aus Horliwka von ihrer Freundin, die beim Brotkaufen getötet wurde. Während der Aufnahme wird das Kind buchstäblich zum Weinen gebracht.
Der gesamte Bericht basiert auf Retraumatisierung.
Das Gleiche passiert in einem Video auf dem YouTube-Kanal der Belteleradiokompanija. Bereits in den ersten Sekunden sagt dort ein Mädchen, dass dies ein „schmerzhaftes Thema“ sei, während ein anderes Kind weint. Die Autorin der Reportage, Daria Ratschko, setzt die Kinder jedoch weiter unter Druck und stellt ihnen unangenehme Fragen: Sie fragt nach den Angriffen, ob sie Angst hatten und ob es normal sei, dass dabei alle Fenster zerbrechen. Ratschkos gesamter Bericht basiert auf der Retraumatisierung der Kinder aus den besetzten Gebieten.
Genauso macht es ihre Kollegin Anastassija Benedisjuk in der Popagandadoku „Donbas. Belarus ist da“, zum Beispiel im Interview mit einem 11-jährigen David aus Mariupol. Zu Beginn des Films sieht man außerdem Mädchen vor der Kamera weinen, deren Namen nicht genannt werden.
„Russische Kinder mit russischen Pässen“
Ein anderes Propagandanarrativ in Belarus dreht sich um die Behauptung „ukrainische Nazis töten russische Kinder“. Russland würde sie dann retten und Belarus sei dabei ein märchenhaft ruhiges Land. Die Organisatoren der „Transporte“ seien Zauberer, die heilen und dabei helfen, die Schrecken der sogenannten Spezialoperation zu vergessen.

In einem Telegram-Video zeigen Kinder aus dem besetzten Teil der Region Cherson, die im März 2024 in Belarus waren, ihre russischen Pässe. Der Paralympiker und glühende Lukaschenko-Anhänger Alexej Talaj, eine Schlüsselfigur bei der Deportation von Kindern aus den besetzten Gebieten nach Belarus, kommentiert dazu im Video: „Das sind russische Kinder mit russischen Pässen.“
Eine andere Propagandareportage des belarussischen Fernsehsenders CTV fokussiert sich indes auf Berichte über Minenverletzungen und andere Verwundungen von Kindern, wie etwa von Swjatoslaw Rytschkow. Swjatoslaw erzählt, er habe eine Schrapnellverletzung an der Lunge erlitten, als ein ukrainischer Panzer auf den Zaun seines Hauses zielte. Danach behauptet er, die Soldaten hätten keinen Krankenwagen zu ihm durchgelassen, stattdessen gemeint: „Lasst ihn sterben.“
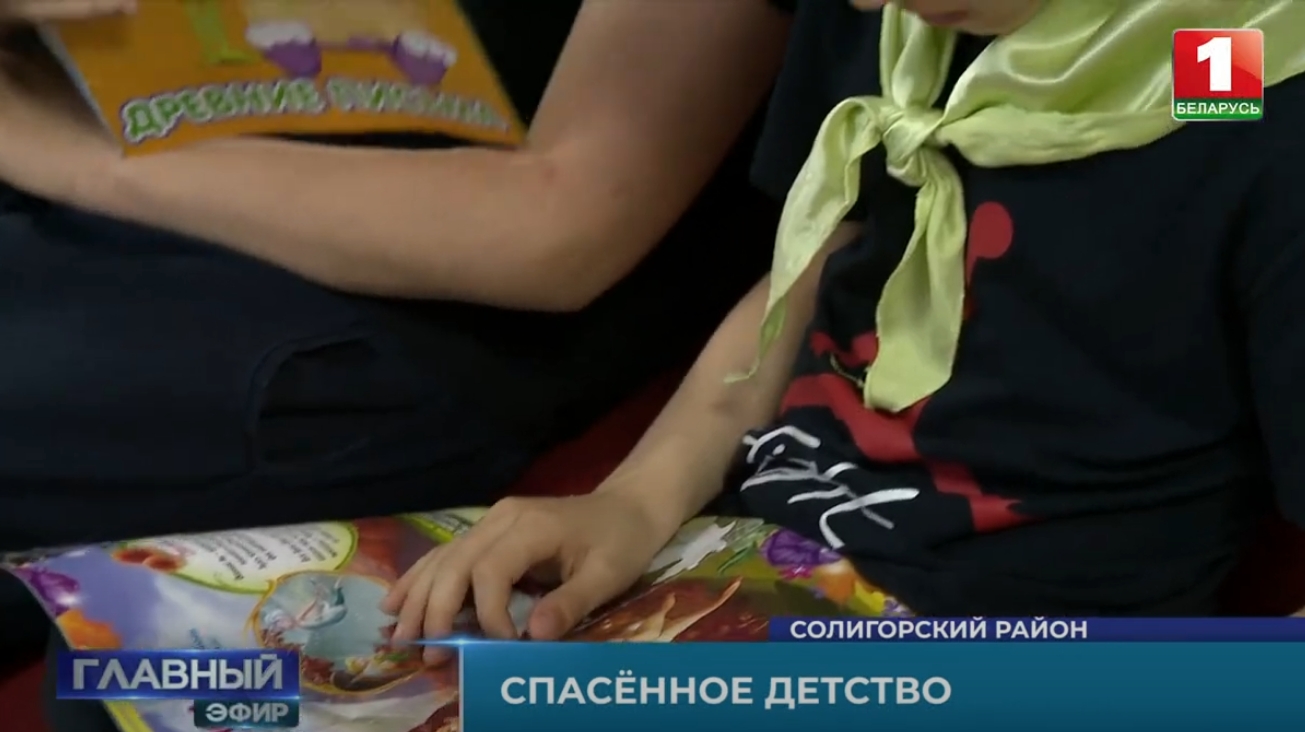
Tatsächlich war es jedoch das ukrainische Militär, das Swjatoslaw Rytschkow nach seiner Verletzung, welche die Journalistin auf dramatische Weise schildert, in ein Militärkrankenhaus in Bachmut brachte. Anschließend wurde er im Intensivwaggon eines Sanitätszuges ins St.-Nikolaus-Krankenhaus von Lwiw gebracht.
„Wenn man die Geschichten hört, drängt sich der Eindruck auf, dass die Kinder einen vorbereiteten Text vor der Kamera ablesen.“
In einem anderen Fall brachte man 11 Kinder in die von Ksenija Lebedijewa moderierte Sendung „Das ist etwas anderes“ des Senders „Belarus“ und kündigte sie als Kinder aus „Orten der DNR“ an. Die Jugendlichen mussten berichten, wie sie die [russische – dek] Besetzung ihrer Städte erlebten und was sich jetzt dort abspielt.
Wenn man die Geschichten hört, drängt sich der Eindruck auf, dass die Kinder einen vorbereiteten Text vor der Kamera ablesen, denn sie reproduzieren nur russische Narrative. So sprechen sie von der „militärische Spezialoperation“, sagen, dass „ukrainische Kämpfer die Stadt planlos beschießen“, dass „Russland sie rettet“ und dass „Mariupol sich zu erholen beginnt“. Auf Nachfrage der Moderatorin antworten die Kinder, dass sie „russische Kinder“ seien.
Einer der Jungen antwortet auf eine bewusst provokante Frage der Moderatorin: Wäre er älter, würde er in den Krieg ziehen, weil die Ukraine in sein Land gekommen sei und Leute wie ihn umbringe.
„Walerija hält ein Sturmgewehr.“
Das Thema der anti-ukrainischen Militarisierung von Kindern und ihrer Bereitschaft, gegen die Ukraine zu kämpfen, wird von der belarussischen Propaganda häufig bespielt. Wie etwa in einem Bericht über den Aufenthalt von Kindern aus Donezk und Mariupol im Sanatorium Wolma im Juni 2022:
„Walerija Ljachowa hält ein Sturmgewehr. Sie sagt, sie habe keine Angst vor Waffen und sei bereit, noch heute für ihr Heimatland in den Krieg zu ziehen, doch sie sei noch nicht alt genug. Lera ist dreizehn…“

Besonders charakteristisch ist der in der Propaganda konstruierte Kontrast zwischen von „der EU, den USA und den Nazis“ ins Unheil gestürzten Kindern in den [russisch – dek] besetzten Gebieten der Ukraine und den glücklichen Kindern in Belarus, denen Batka eine glückliche und unbeschwerte Kindheit beschere. In verschiedenen Sendungen wird die Verbringung von Kindern aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Belarus als Abenteuer beschrieben, von Zauberern organisiert, die sie mit einem schönen Zug ins Märchenland bringen. Hier ist es ruhig, es gibt leckeres Essen und es wird gefeiert.
„Wir sind ein Volk“
Belarussische Medien berichten außerdem häufig über Veranstaltungen, bei denen Kinder aus der Besatzung die russische Ideologie der „Dreieinigkeit der Völker“, der „russischen Welt“ und des „Unionsstaates“ verbreiten.
So sangen beispielsweise Kinder aus Horliwka nach der Neujahrsshow im Palast der Republik in Minsk, wahrscheinlich auf Anregung des Organisators Pawlo Tschulochin: „Wir sind eine Familie. Zusammen sind wir eine Rus‘ – Horliwka und Belarus!“ Oft werden ukrainische Kinder auch in Propagandaveranstaltungen gezeigt, in denen sie als „russisch“ und die besetzten Gebiete als „neue Regionen Russlands“ bezeichnet werden. Auch Alexej Talaj nennt in einem Video diese Gebiete einen Teil der Russischen Föderation und ein Mädchen aus der besetzten Region Donezk ein „russisches Mädchen“.

Im Video von einer Aufführung im belarussischen Kinderferienlager „Dubrawa“ verkündet gar der Kulturberater des russischen Botschafters, Sergej Afonin, ukrainischen Kindern aus den besetzten Gebieten seine ideologische Agenda: „Wenn die russischen Jungs erst das heilige Land im Donbas befreien, haben die Kinder schönste Aussichten auf ein Leben in den gelobten Ländern Russland und Belarus.“
Für die Kinder werden außerdem Ausflüge zu „Orten des Ruhmes“ organisiert und diese Veranstaltungen aktiv in den Medien verbreitet. So wurden Kinder mit Behinderungen aus Donezk Teil einer Propagandakampagne der Alexej-Talaj-Stiftung zum Großen Vaterländischen Krieg und machten einen Ausflug zum „Museum des Großen Vaterländischen Krieges“. Das Programm für Kinder aus Dokutschajewsk und Mariupol umfasste einen Besuch der Festung Brest.

„Niemanden kümmern die Interessen der Kinder“
Onysija Synjuk, Rechtsanalystin am ZMINA-Menschenrechtszentrum, betont, dass sich niemand um die Interessen der Kinder kümmert, wenn ukrainische Kinder in Belarus so zu Propagandazwecken benutzt werden: „Niemand kümmert sich darum, dass solche Beiträge sowohl Sicherheits- als auch Datenschutzaspekte ignorieren, indem sie persönliche Informationen über die Kinder preisgeben. Außerdem werden die Kinder durch gewisse Fragen retraumatisiert.“ Die Expertin nimmt weiter an, dass die militarisierten und indoktrinierten Kinder aus den besetzten Gebieten später dazu benutzt werden, ihre Altersgenossen zu beeinflussen.
Weitere Themen
„Ist es nicht Patriotismus, wenn alle Kinder zu uns gehören?“
Geburt und Tod der Russischen Welt
Video #33: Putin zählt Ukrainer und Belarussen zur „großen russischen Nation“