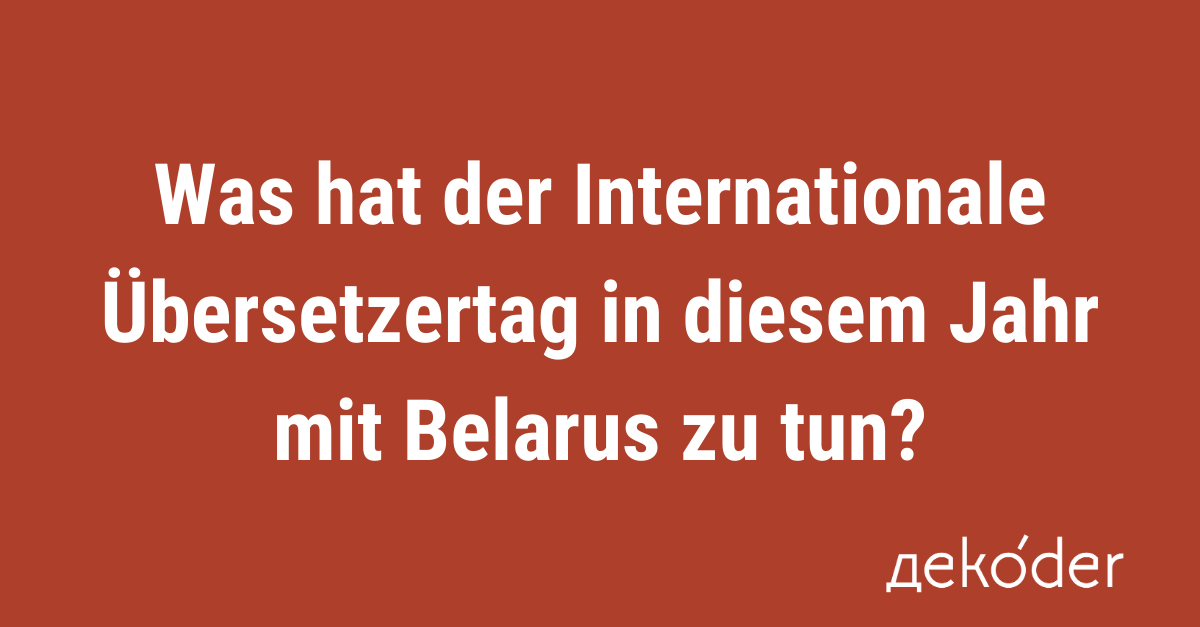Auch am vergangenen Sonntag beim Marsch der Freiheit konnte man wieder hören, wie Demonstranten diese Losung schrien: Shywe Belarus!, Es lebe Belarus! Zudem sieht man den Ausruf auch immer wieder auf Wänden, Plakaten oder Fahnen. Es ist nicht so, dass diese Beschwörungsformel erst seit dem Beginn der Proteste im Sommer in Belarus populär geworden ist. Auf Kundgebungen und Demonstrationen der Opposition gehört sie schon lange zum Standardrepertoire, um seinen Protest gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auszudrücken und die Souveränität der Republik Belarus zu betonen.
Aber woher stammt diese Losung eigentlich? Wann hat sie sich entwickelt? Und in welchen unterschiedlichen Kontexten wurde sie seitdem verwendet? Auf diese Fragen gibt der Historiker Denis Martinowitsch für das belarussische Medienportal tut.by eine Antwort.

Der Historiker Alexej Kawka sieht den Ursprung dieses Ausspruchs in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als manche Teilnehmer am Aufstand von Kastus Kalinouski die Parole benutzten: „Wen liebst du? – Ich liebe Belarus. – Ganz meinerseits.“
Doch die genaue Wortkombination trat erstmals am Ende eines Gedichts von Janka Kupala auf: „Ein Klagen, ein Schrei, dass Belarus lebt!“, entstanden in den Jahren 1905 bis 1907, als damals im Russischen Reich gerade eine Revolution im Gange war.
Wer liebt nicht dieses Feld, den Wald,
den grünen Garten, die schnatternde Gans!
Der Wirbelsturm, der hier manchmal klagt –
ist ein Klagen, ein Schrei, dass Belarus lebt!
Aber nicht nur Janka Kupala, auch andere Dichter, die in der Zeitung Nasha Niva publizierten, verwendeten aktiv diesen Spruch. Kein Wunder, dass im Editorial einer Ausgabe von 1911 stand:
„Die belarussische Nationalbewegung wächst, die armseligen, in Vergessenheit geratenen belarussischen Dörfer erwachen zu einem neuen, eigenständigen Leben; unsere Städte und Ortschaften erwachen und werden ihrer nationalen Namen gewahr. Es erwacht die riesige, kriwitschische Weite mit unseren Äckern, Wiesen und Wäldern, und in den Liedern unserer Volkssänger erschallt, dass Belarus lebt!“.
Wie wurde diese Losung vor dem Zweiten Weltkrieg verwendet?
Sehr aktiv. Aber bevor wir diese Frage beantworten, machen wir einen kleinen Exkurs.
1917 fand in Minsk der Erste Allbelarussische Kongress statt. Die belarussischen Staatsbeamten betonten immer wieder dessen große Bedeutung. „Diese Volksversammlung hat die zentralen Werte erkennen lassen, die für uns bis zum heutigen Tag Gültigkeit haben: ein eigener Staat, dessen sozialer Charakter und das Faktum, dass nur das Volk, sein Wille, seine kollektive Vernunft und seine politische Führung ein echter Quell der Unabhängigkeit sein können“, erklärte Alexander Lukaschenko 2017.

„Erstmals seit vielen Jahrhunderten zeigte das belarussische Volk seinen Willen zur Selbstbestimmung, und erstmals wurde die Idee einer belarussischen Staatlichkeit geäußert. Aus dieser Idee, der Idee des Allbelarussischen Kongresses, geht die Praxis der Allbelarussischen Versammlungen hervor“, sagte Igor Marsaljuk ebenfalls 2017 in einer Sendung des Staatsfernsehens ONT.
Auf eben diesem Kongress erklang die Losung „Es lebe das freie Belarus!“. Bis zum Krieg behielt die Losung in der Belarussischen SSR ihre Bedeutung bei. Nur dann in der Variante „Es lebe das sowjetische Belarus!“. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde diese Losung noch verwendet, wie auf dem Plakat zu sehen ist.
Wie wurde die Losung während des Krieges verwendet?
Der Verweis auf die Zeit der nationalsozialistischen Okkupation ist ein Lieblingsmotiv der belarussischen Propagandisten. Leider lässt auch der habilitierte Geschichtswissenschaftler Igor Marsaljuk es nicht aus.
„Man kann sich natürlich auf Verse von Kupala oder Pimen Pantschenko beziehen, in denen diese Wendung vorkommt. Aber wenn wir nicht von der Wortverbindung sprechen, sondern von der Grußform, dann sehen wir in den Statuten des Weißruthenischen Jugendwerks, dass man als Rangniederer auf den Ranghöheren zuging, ihn begrüßte mit: Es lebe Belarus und dabei die Hand zum Hitlergruß hob. Die Antwort darauf war kurz und bündig: Es lebe. Dieser Gruß wurde, genauso wie Sieg heil!, während der deutsch-faschistischen Besetzung der BSSR kanonisch und in weiterer Folge zu einer konstanten, alltäglichen Formel der belarussischen Emigration in Kanada und den Vereinigten Staaten“, sagte Marsaljuk auf CTV.
Während des Krieges gab es im besetzten Belarus tatsächlich eine solche Organisation mit dem Namen Weißruthenisches Jugendwerk. Sie wurde 1943 gegründet, ein Jahr vor der Befreiung. Und ja, ihre Mitglieder grüßten wirklich mit Hitlergruß. Doch auf ihrem Höhepunkt hatte die Organisation gerade mal 12.600 Mitglieder, von denen noch dazu später ein Teil zu den Partisanen überlief. Doch gleichzeitig wurde diese Losung auch auf der anderen Seite der Barrikaden verwendet. „Verfechter der BSSR und später auch Partisanen und Untergrundkämpfer im Zweiten Weltkrieg riefen: ‚Es lebe das sowjetische Belarus!‘“, schrieb 2007 die Zeitung SB. Belarus segodnja. Während des Krieges entstand ein Marschlied der belarussischen Partisanen. Ein kurzes Fragment daraus zitierte E. Tumas vom Lehrstuhl für Chor und Gesang der Belarussischen Universität für Kunst und Kultur. Wir bringen einen längeren Ausschnitt:
Niemals wird erliegen den heftigen Bränden
unser großes und ruhmreiches Land.
Auf in den Kampf für die Heimat, Genosse,
schließ dich den Partisanen an.
Am preußischen Henker
für Dorf und Haus
ruft das Volk zur Rache auf.
Zum Angriff bereit sind die Waldsoldaten,
Granaten krachen, Gewehre donnern –
es lebe Belarus! Es lebe hoch!
Dieser Text ist in der Werksammlung von Pimen Pantschenko zu finden, einem Klassiker der belarussischen Literatur. Es handelt sich um eine Übersetzung des vom russischen Dichter Alexej Surkow verfassten Partisanenmarsches. Der Band, in dem das Gedicht erschien, wurde 1981 in einer Auflage von 17.000 Stück veröffentlicht. Die Losung Es lebe Belarus irritierte niemanden.
Wie der Slogan „Es lebe Belarus“ wieder aktuell wurde
Nach dem Krieg wurde die Losung in der Emigration aktiv verwendet, während sie in der BSSR in den Hintergrund trat. Aktuelle Bedeutung erlangte sie durch die Belarussische Nationale Front (BNF) und die politischen Ereignisse Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre. Doch nach dem Machtantritt Alexander Lukaschenkos ereilte die Parole Es lebe Belarus dasselbe Schicksal wie die weiß-rot-weiße Fahne: Die staatlichen Medien begannen, sie ausschließlich mit der Opposition im Allgemeinen und der BNF im Besonderen zu assoziieren. Diese Wahrnehmung herrschte lange Zeit vor und beeinflusste die Haltung eines Teils der Gesellschaft zu nationaler Symbolik und zu dieser Losung.
In den 2010er Jahren kehrte der Slogan wieder auf die Tagesordnung zurück. Die Opposition im ursprünglichen Wortsinn war praktisch zur Gänze vernichtet. Die Parteien (auch die BNF) hörten in diesen Jahren auf, das politische Geschehen mitzugestalten. Gleichzeitig traten anderweitig politisch aktive Belarussen bei politischen Aktionen weiterhin mit nationaler Symbolik auf und skandierten Es lebe Belarus! In der Folge wurden sowohl die nationale Fahne als auch die Losung nicht mehr nur der Opposition zugeordnet. Zumal: Ab dem Jahr 1990 erschien sie regelmäßig als Slogan auf der Titelseite der Narodnaja Gaseta, einer Publikation des Parlaments. Der oben erwähnte Igor Marsaljuk ist übrigens Abgeordneter des Repräsentantenhauses.
Seit den 1990er Jahren ist einiges an Zeit vergangen. Eine neue Generation ist herangewachsen, die bereits im unabhängigen Belarus zur Schule ging, Geschichte und Literatur des eigenen Landes gelernt hat und in der Lage war, selbst ihre Schlüsse zu ziehen. „Für Belarus!, Es lebe Belarus! oder Blühe, Belarus! – im Grunde ist das alles dasselbe mit anderen Worten. Ist es denn so außergewöhnlich oder gar – das fehlte gerade noch – das exklusive Recht bestimmter Parteien, seinem Land Wohlergehen zu wünschen, zu betonen, dass es lebt (und nicht im Sterben liegt und nicht untergeht – Gott bewahre!)? Soll das heißen, ein normaler Mensch, der mit Politik nichts am Hut hat, darf nicht einmal ein paar schöne Worte über sein eigenes Land verlieren?“, stellte 2007 die Zeitung SB. Belarus segodnja die rhetorische Frage. „Heimatliebe, Nationalbewusstsein oder, wenn man so will, ‚Bewusstheit‘ sind heute der Normalzustand jedes Belarussen.“
Weitere Themen
Neues belarussisches Wörterbuch
Sound des belarussischen Protests
„Wir brauchen keine starken Anführer – wir brauchen eine starke Gesellschaft“