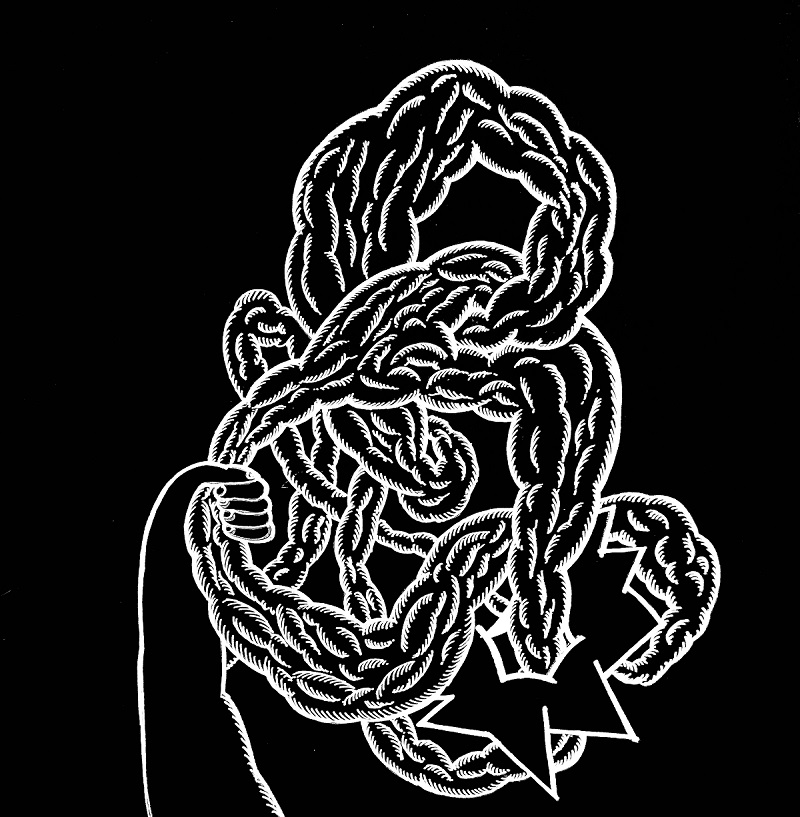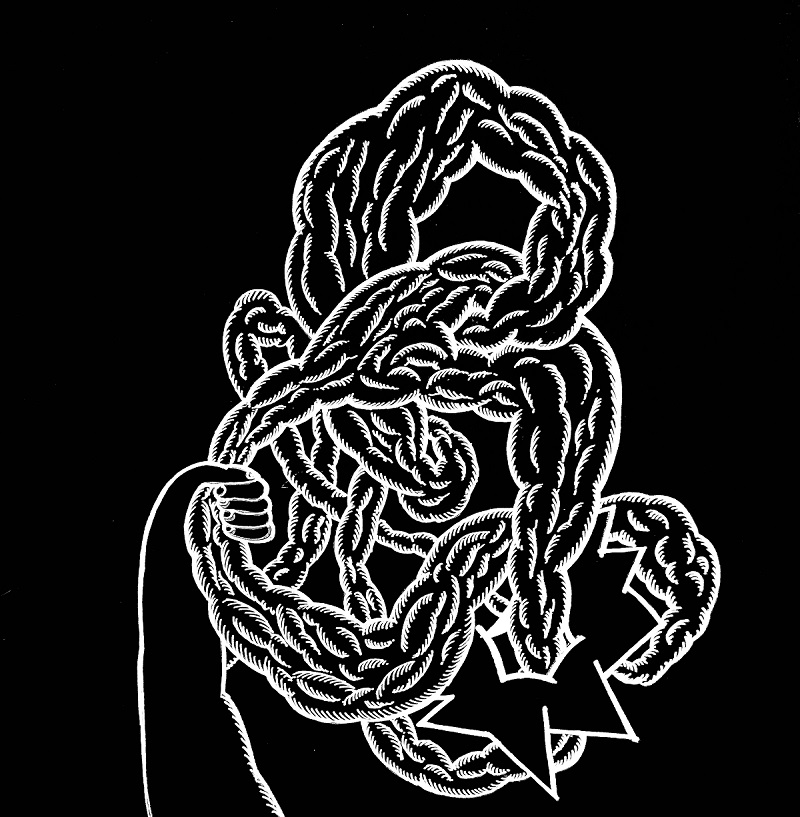Kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine protestierten Belarussen trotz der massiven Repressionen in ihrem Land gegen die kriegerische Handlung des Kreml. Manche Belarussen beteiligten sich bei Sabotageakten an den Eisenbahnstrecken, die das russische Militär für den Transport von Technik und Gerät nutzte. In Umfragen schien sich immer wieder zu bestätigen, dass große Teile der belarussischen Gesellschaft gegen den Krieg in der Ukraine sind und vor allem gegen eine direkte Beteiligung von Seiten der belarussischen Machthaber um Alexander Lukaschenko, der sich allerdings von Anfang in den Krieg verstrickte.
Wie sehen die Belarussen den Krieg heute? Wie beurteilen sie die angekündigte Stationierung russischer Atomwaffen in ihrem Land und das Verhältnis zum Westen? Solche Fragen sind nicht leicht zu beantworten, da es nur wenige aktuelle soziologische Daten aus Belarus gibt. Unabhängige Umfrage-Institute existieren nur im Exil. Zumindest Anhaltspunkte liefern jedoch die regelmäßigen Online-Interviews des britischen Thinktanks Chatham House unter der Leitung des Soziologen Ryhor Astapenia. In der aktuellen 15. Umfragerunde wurden im März 804 Personen befragt. Die Autoren der Studie weisen auf nicht vollständig korrigierbare Verzerrungen hin: zum einen durch den „Angst-Faktor“ in einem repressiv regierten Land wie Belarus, zum anderen dadurch, dass die Befragung nur online durchgeführt werden konnte.
Igor Lenkewitsch von Reform.by hat sich die Umfrage von Chatham House angeschaut und ausgewertet.
Chatham House hat die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter dem Titel Die Werte der Belarussen und ihre Haltung zum Krieg veröffentlicht. Unsere Landsleute wollen weiterhin keinen Krieg führen. Die Versuche des Regimes, aus den Nachbarländern Feindbilder zu schmieden, haben keine nennenswerte Dividende erbracht. Aber auch der über ein Jahr andauernde Krieg, die Gräueltaten der russischen Besatzer und der Beschuss friedlicher ukrainischer Städte hatten keinen Einfluss auf die Haltung der Belarussen zu den Ereignissen rund um unser Land.
Ein Krieg ohne Unterstützung
Die meisten Belarussen (44 Prozent der Befragten) unterstützen nicht das Vorgehen der russischen Armee in der Ukraine. Ein weiteres Viertel tut sich mit einer Antwort schwer. 18 Prozent unterstützen es mit Bestimmtheit und 15 Prozent sagen, sie unterstützen es eher.
Bezeichnend ist auch, wie die Unterstützung für die kriegerischen Handlungen Russlands in der Ukraine davon abhängt, welche Medien die Befragten bevorzugen. Anhand der Grafik wird deutlich, dass es nur beim Publikum staatlicher Medien mehr Unterstützer für das Vorgehen der russischen Streitkräfte gab als Gegner.
Dabei wollen die Belarussen keine unmittelbare Beteiligung an den kriegerischen Handlungen. Auf die Frage „Was sollte Belarus jetzt angesichts der Kriegshandlungen zwischen Russland und der Ukraine unternehmen?“ antworteten 30 Prozent, dass eine vollkommene Neutralität des Landes vonnöten sei, dass sämtliche ausländische Truppen von belarussischem Staatsgebiet abgezogen werden müssen, und dass man sich nicht zugunsten einer der Seiten äußern sollte. Weitere 30 Prozent sind dafür, Russland zwar zu unterstützen, sich aber an dem militärischen Konflikt nicht zu beteiligen. Sechs Prozent sind bereit, die Ukraine ohne einen Kriegsbeitritt von Belarus zu unterstützen. Und der Anteil derjenigen, die einen [aktiven – dek] Kriegseintritt auf einer der beiden Seiten wollen, liegt zusammengenommen bei wenigen Prozentpunkten.
Wer wird siegen?
Es sind allerdings nur relativ wenige, die an einen Sieg der Ukraine glauben, nämlich 15 Prozent. Eine Mehrheit jedoch (46 Prozent) ist der Ansicht, dass Russland siegen wird. Bemerkenswert ist, dass nach einem Jahr Krieg, nach dem Rückzug der russischen Streitkräfte von Kyjiw und Tschernihiw sowie ihrem Abzug aus Cherson sich die Meinung der Belarussen zu einem möglichen Sieger praktisch nicht verändert hat. Möglicherweise ist das eine Folge langjähriger Stereotype über die Macht und die Dimension Russlands und die Unbesiegbarkeit seiner Armee, die heute von der russischen und belarussischen Propaganda verstärkt verbreitet werden. Gleichzeitig tat sich ein beträchtlicher Teil der Befragten schwer, auf diese Frage zu antworten.
Über die Hälfte der Belarussen treten für eine umgehende Beendigung des Krieges und für Friedensverhandlungen ein.
Die meisten Nutzer nichtstaatlicher Medien sind derweil überzeugt, dass der Krieg erst dann beendet werden sollte, wenn die Ukraine ihre Ziele erreicht hat. Beim Publikum der staatlichen Medien ist der Anteil jener, die den Krieg erst dann beendet sehen wollen, wenn Russland seine Ziele erreicht hat, etwas geringer, nämlich 43 Prozent.
Insgesamt ist zu konstatieren, dass sich die Polarisierung der belarussischen Gesellschaft fortsetzt. Doch auch wenn sich die Haltung zum Krieg bei Anhängern und Gegnern des Regimes unterscheidet, möchte keine der beiden Gruppen eine unmittelbare belarussische Beteiligung am Krieg. Auf welcher Seite die Sympathien der Befragten auch liegen mögen, die Vorstellung, dass Belarus sich unmittelbar am Krieg beteiligen sollte, ist nach wie vor nur marginal verbreitet.
Mit Atomwaffen oder ohne?
Bei den Antworten auf diese Frage hat es keinerlei nennenswerte Veränderungen gegeben. Die überwiegende Mehrheit der Belarussen, nach wie vor 74 Prozent, steht einer Stationierung von Atomwaffen in unserem Land ablehnend gegenüber.
Der Anteil der Befürworter dieser Idee hat sich seit August vergangenen Jahres leicht erhöht – von 19 auf 25 Prozent. Das ist wohl auf den systematischen Einsatz der staatlichen Propaganda zurückzuführen, die die Stimmung mit angeblich vorhandenen Bedrohungen an unseren Grenzen anheizt.
Allerdings ist selbst bei den Anhängern des Regimes (dem Publikum der staatlichen Medien) eine Mehrheit gegen die Stationierung von Atomwaffen in Belarus.
Mit wem werden wir Freunde sein?
Interessant ist auch, dass sich ungeachtet der Anstrengungen der Propaganda die Haltung der Belarussen zu den Nachbarländern praktisch nicht verändert hat.
Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Ukraine, Polen, Litauen und den Ländern der EU gegenüber nach wie vor positiv oder sehr positiv eingestellt. Am schlechtesten ist das Verhältnis zu den USA, allerdings sind auch hier jene, die diesem Staat ablehnend gegenüberstehen, in der Minderheit.
Was die außenpolitischen Präferenzen der Belarussen angeht, so sind die ebenfalls seit August 2022 praktisch unverändert geblieben. Für ein geopolitisches Bündnis mit der EU treten 14 Prozent der Befragten ein, und für ein Bündnis mit Russland 38 Prozent. 23 Prozent sind überzeugt, dass Belarus sich besser aus allen möglichen geopolitischen Bündnissen heraushalten sollte.
Auf die Frage „Welche Art von Bündnis mit Russland ist für Sie am ehesten akzeptabel?“ sprachen sich 34 Prozent für eine Freihandelszone aus. Im August 2022 hatte ein gleicher Anteil der Befragten diese Antwort gewählt. Anhänger eines Beitritts von Belarus zur Russischen Föderation gibt es nach wie vor wenige, insgesamt vier Prozent. Mehr als ein Drittel der Befragten befürworten einen gemeinsamen Wirtschaftsraum ohne politische Vereinigung.
Die Studie zeigt insgesamt, dass die Präferenzen in der belarussischen Gesellschaft im vergangenen Jahr unverändert geblieben sind – obwohl die Propaganda mehr Druck macht, das Regime die Ukraine und den Westen als Feindbild darstellt und schon mehrere Monate eine Kriegshysterie geschürt wird. Es ist nicht gelungen, die Haltung der Belarussen zum Krieg oder ihren Nachbarn zu ändern. Und die vom Regime gepredigte Konzeption einer von Feinden belagerten Festung hat in den Herzen der meisten Bürger unseres Landes keine Unterstützung gefunden.
Gleichzeitig haben weder der anhaltende Krieg noch die Verbrechen der russischen Streitkräfte die Haltung der Belarussen zum Geschehen grundlegend verändert – ebenso wenig der Beschuss ukrainischer Städte, das Sterben friedlicher Zivilisten und die militaristische Rhetorik des Regimes. Die überwiegende Mehrheit hofft anscheinend weiter darauf, dass all diese Ereignisse keine ernsten Auswirkungen auf ihr Alltagsleben haben werden. So zu tun, als würde nichts geschehen, ist jedoch nicht die beste Reaktion auf die Veränderungen, die sich derzeit in der Welt vollziehen.
Weitere Themen
„Russland wird aufs Schrecklichste verlieren“
FAQ #5: Welche Rolle spielt eigentlich Belarus im Ukraine-Krieg?
Lukaschenko auf den Spuren des Totalitarismus