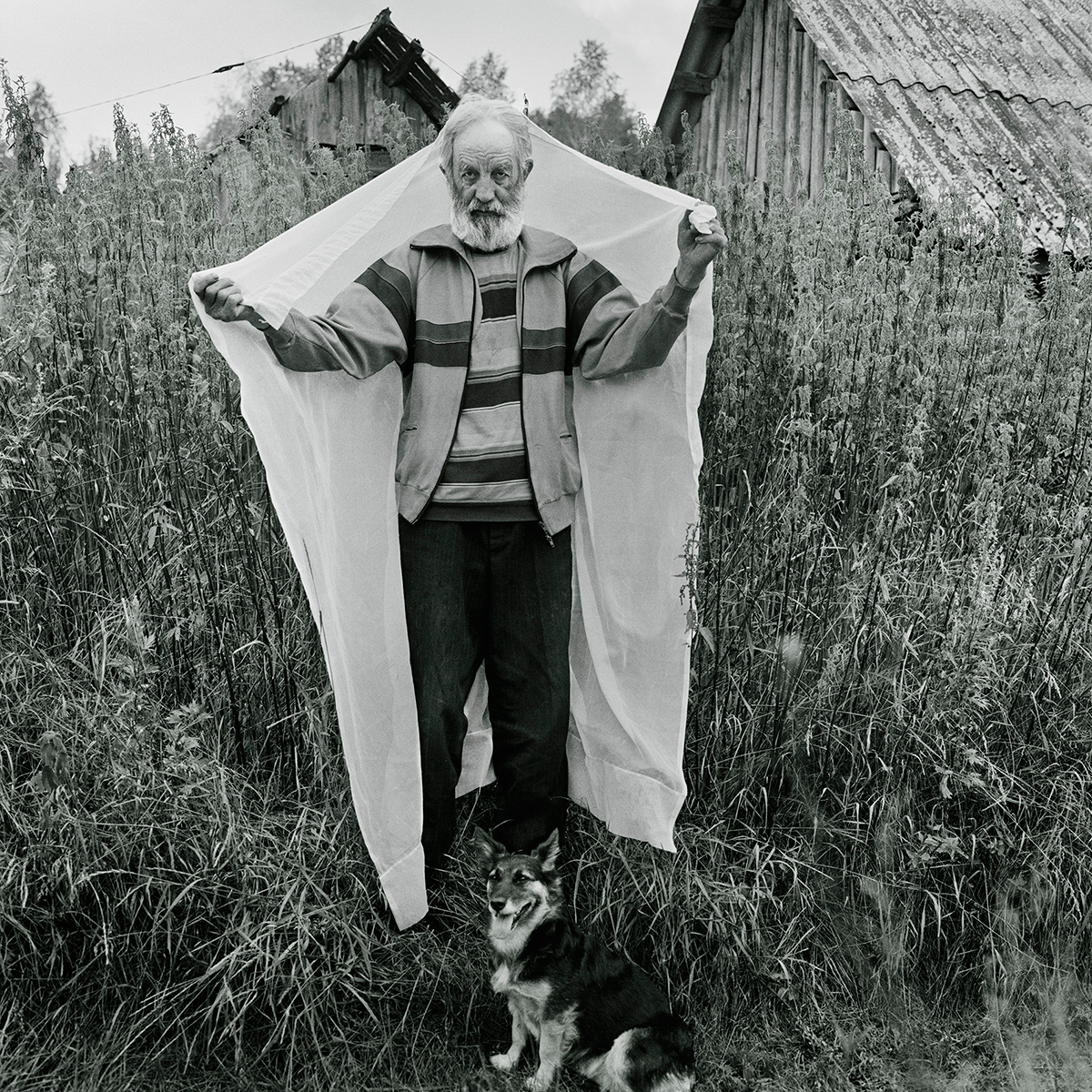Etwa 1500 Belarussen sollen im russischen Angriffskrieg auf Seiten der Ukraine kämpfen, 1000 beim Kalinouski-Regiment, das auch bei Bachmut im Einsatz ist. Viele Belarussen haben für das Nachbarland zu den Waffen gegriffen, weil sie die Ukrainer unterstützen wollen, auch weil sie das Schicksal von Belarus in den Händen des Kremls sehen und weil Machthaber Lukaschenko sich tief in den Krieg verstrickt hat.
Einer von diesen Freiwilligen ist Sonja – so zumindest sein etwas seltsamer Kampfname, der übersetzt so viel wie Schlafmütze bedeutet. Er dient als stellvertretender Kommandeur einer Maschinengewehr-Einheit im Kalinouski-Regiment. Mit dem Kämpfer wider Willen, der vor dem Krieg im Kindergarten arbeitete und der in Belarus nie gedient hat, hat das belarussische Online-Medium Zerkalo ein langes Gespräch geführt: über seine Motivation, doch zur Waffe zu greifen, über die Kämpfe an der Front, über seine Pläne und darüber, was der Krieg mit einem macht.
Das Interview beginnt eine halbe Stunde später als geplant: „Sonja“ hat verschlafen. Erst vor ein paar Tagen ist er von seinem zweiten Kampfeinsatz in Bachmut zurückgekehrt. Zwei Monate war er dort. Heute ist sein fünfter Urlaubstag. Sieben liegen noch vor ihm.
„Ich sag’s, wie es ist, ich bin eigentlich Hedonist und habe mit dem Militär überhaupt nichts am Hut. Diese ganzen Entbehrungen machen keinen Spaß, aber wenn’s drauf ankommt, dann verschlafe ich nicht“, erklärt er seine Verspätung eloquent. „Nur damit Sie verstehen: Bei unseren letzten Kampfeinsätzen mussten wir um drei Uhr nachts aufstehen, hatten eine Stunde zum Fertigmachen und waren im Morgengrauen in unseren Stellungen. Als der Kommandeur vor dem Urlaub zu mir sagte: ‚Kannst bis sechs im Bett bleiben‘, dachte ich: ‚Gott, endlich mal ausschlafen.‘ Was meinen Kampfnamen angeht, das nehme ich nicht so ernst. Die anderen Jungs suchen sich Namen wie Warjagow (Wikinger) oder Achilles, aber mir war das ziemlich egal. Beim ersten Frühsport im Trainingslager habe ich verschlafen, da sagten sie: ‚Du bist echt ne Schlafmütze [auf Russisch sonja – dek].‘ Da hatte ich meinen Kampfnamen.
Wenn ich mich vorstelle, lachen die Ukrainer immer – zumal wir in einer Maschinengewehr-Einheit sind, an vorderster Front, wir kundschaften aus, greifen an, wehren Attacken ab – aber dann freunden wir uns an. Da geht’s nicht um den Kampfnamen, sondern darum, wie du kämpfst. Wenn du ein schlechter Kämpfer bist, kannst du dich noch so oft Wikinger nennen, das wird dir auch nicht helfen.”
Sonja ist jung, groß wie ein Basketballspieler und hat ein Babyface. Er spricht Englisch, liest Bücher auf Deutsch und macht sich Sorgen, dass seine Frisur heute nicht sitzt. Von Beruf ist er Jurist, aber im Herzen Romantiker. Er hat in Belarus, Polen und Russland gelebt und als Gerichtsvollzieher, Kellner, Autowäscher, Tischler, Packer, Leiter eines Steinbruchs, Touristen-Guide, Chauffeur und Berater in einem Callcenter gearbeitet. Auf die Frage, warum er so oft den Arbeitsplatz gewechselt hat, sagt er, das sei „sein Charakter“, er habe lange nicht gewusst, wo er hingehöre.
„Aber jetzt habe ich meinen Platz gefunden“, sagt er. „Das ist seltsam, weil ich mich über Armeeleute immer lustig gemacht habe. Ich hielt sie für hohl und hilflos. Aber ich habe das Gefühl, eine wichtige Arbeit zu machen: Ich rette Menschen, kämpfe für sie. Trotzdem bin ich wahrscheinlich kein echter Soldat. Ich bin im Krieg gelandet, das ist wohl etwas anderes als die normale Armee.“
Sonja war nie bei der Armee, stattdessen hat er in einem Kindergarten gearbeitet. Er ist zufällig dort gelandet, als er eines Tages im Internet nach Jobs suchte – aber nicht nach Branchen, sondern nach Entfernung. Das nächste war der Kindergarten. Also rief er dort an.
2022 hat Sonja Kindern und Erwachsenen Englisch beigebracht und wollte nicht weg aus Belarus. Sein Motto war: „Wenn alle gehen, bleibe ich.“ Aber als im Februar der Krieg begann, änderte er seine Meinung.
„Im Schützengraben werde ich oft gefragt, warum ich jetzt in der Ukraine bin. Ich weiß nie, was ich darauf antworten soll. Na ja, warum wohl? Hier sterben Menschen, unter anderem auch durch unsere Schuld, und ich soll zu Hause sitzen?“, erklärt er. „Es gibt da diesen Film, Shutter Island. Leonardo Di Caprio spielt darin einen Feldmarschall, der den Verstand verliert. Am Ende sagt er diesen schönen Satz: ‚Was ist besser – als Monster zu leben oder als Mensch zu sterben?‘ Ich habe meine Wahl getroffen. Gleich am 24. Februar. An dem Abend sagte ich zu meinen Eltern, dass ich fahren werde. Wie sie reagiert haben? Wie sollen normale Eltern schon darauf reagieren? Meine Mutter wurde hysterisch, mein Vater sagte: ‚Bist du blöd? Denk doch mal nach!‘ Aber sie wussten, dass sie mich nicht aufhalten können. Ich bin stur wie ein Bock. Doch weil mein Vater krank wurde, musste ich die Abreise verschieben.“
Ich sag‘s euch lieber gleich, ich hab noch nie gekämpft, kann sein, dass ich mir die Hosen vollmache
Im Sommer 2022 verließ Sonja verließ Belarus. Bei der Einreise nach Polen wurde er festgehalten. Fünf Jahre zuvor war er dort in einen Autounfall geraten und hatte seine Strafe nicht bezahlt. Er sagt, er habe seinerzeit beim Gericht angerufen und sich erkundigt, dort habe es geheißen, der Fall sei erledigt. Sonja vermutet, dass nach Beginn des Krieges die Akten von Belarussen wieder hervorgeholt wurden, unter anderem auch seine. Im Endeffekt musste er ins Gefängnis und nach der Freilassung eine elektronische Fessel tragen. Als endlich alles geklärt war, war es schon Winter.
Dann meldete er sich als Freiwilliger bei der ukrainischen Botschaft in Warschau, wollte in die ukrainische Armee eintreten. Sie lehnten ab, aber gaben ihm die Nummer des Kalinouski-Regiments. In der belarussischen Einheit nahm man ihn zwar auf, aber der Hindernislauf war damit nicht beendet: Kurz vor seiner Abfahrt bekam Sonja Windpocken. Zwei Wochen lang lag er mit Fieber im Bett. Erst dann ging es endlich in die Ukraine, zu den Übungen ins Trainingslager – und dann an die Front.

„In meiner Familie wurde Sport groß geschrieben, ich musste immer ordentlich trainieren. Ich habe lange gepumpt, wollte den Mädels gefallen, und jetzt zahlt es sich endlich aus – am Maschinengewehr“, grinst Sonja, als er sich erinnert, wie er in seine Einheit kam. „Ich wusste schon im Trainingscamp, dass ich in die MG-Einheit will. Bei den Übungen stellte ich mich gut an. Und nach dem ersten Kampfeinsatz war es irgendwie von selbst klar, was ich machen werde. Es stellte sich obendrein heraus, dass ich mutig bin.“
Woran haben Sie das gemerkt?
„Erst wurde ich dem Bataillon Volat zugeteilt, aber als ich Senat kennenlernte (den stellvertretenden Kommandeur des Bataillon Litwin – Anm. d. Red.), habe ich mich ummelden lassen, damit ich unter seine Führung komme. Zum ersten Kampfeinsatz nahm er mich mit in die Oblast Charkiw. Bevor wir losfuhren, ging ich zu ihm und den anderen Jungs und hab gesagt: ‚Ich sag‘s euch lieber gleich, ich hab noch nie gekämpft, kann sein, dass ich mir die Hosen vollmache.‘ Ich dachte, es ist besser, wenn ich sage, dass ich ein Feigling bin. Wenn ich dann keiner sein sollte, umso besser, und wenn doch, dann hab´ ich sie wenigstens vorgewarnt. Ich wollte jedenfalls nicht den Macker spielen.
Als wir ankamen und aus dem Auto stiegen, ging sofort der Beschuss los. Ein Panzer hatte uns im Visier. Wir liefen in irgendeinen Keller. Wir waren zu viert: ich, Senat und noch zwei andere großartige Männer – Weras und Helm. Sie hatten alle Erfahrung, nur ich war ganz neu. Und plötzlich, mitten in diesem Beschuss, wurde mir klar, dass ich keine Angst habe. In diesem Keller saßen wir vier Tage. Nachts gingen wir ins Feld, gruben Schützengräben und deckten Helm, damit er als Scharfschütze ein paar von denen umnieten konnte. Nach den vier Tagen sagte Senat: ‚Du bleibst hier vorne, du hast keine Angst.‘ Wie er das gemerkt hat? Weil ich eingeschlafen bin. Ganz in der Nähe schossen Panzer und die Artillerie, der Putz rieselte von der Decke, und ich sagte: ‚Hört mal, wir sitzen hier noch ne Weile, ich werd mal ne Runde pennen.‘ Ich zog die Weste aus, den Helm, kroch in den Schlafsack und war weg. Senat hat danach gesagt: ‚Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so wenig Angst hatte.‘ Und ich: ‚Vielleicht hast du noch nie jemanden gesehen, der so dumm ist. Das geht meist Hand in Hand.‘“
Außerdem müssen Sie ziemlich stark sein. Wie viel wiegt so ein Maschinengewehr?
„Ich habe ein Minimi 5,56, das wiegt zwölf Kilo, und ein CZ-Gewehr. Aber das Maschinengewehr kommt selbst für einen Kämpfer mit meiner Spezialisierung erst an zehnter Stelle. Spaten, Schlafsack, Besteck, mit dem du dein Dosenfleisch löffelst, und Wasser – das sind deine Hauptwaffen. Geballer kommt selbst auf dem Schlachtfeld gar nicht so oft vor, und wenn, dann nicht gezielt. Meistens kommt es aus Panzern, Minenwerfern und Flugzeugen, und wenn du dich retten willst, musst du dich schnell und tief eingraben können. Einmal gaben wir buchstäblich 200 Meter von den feindlichen Positionen entfernt den ukrainischen Artilleristen die Koordinaten durch. Sie zielten und schossen daneben, direkt auf uns. Ich hatte buchstäblich 30 Sekunden zwischen zwei Einschlägen, um mir ein Loch zu buddeln und wie ein Strauß meinen Kopf reinzustecken. Wenn dich ein Geschoss am Arsch oder am Bein erwischt, ist es halb so wild. Aber wenn’s dein Kopf ist, bist du tot.
Ich bin ein religiöser Mensch und glaube an Schicksal, deshalb seh’ ich die Beschüsse gelassen. Ich vertraue darauf, dass es mich nicht erwischt, weil ich meine Mission noch nicht erfüllt habe.“
Welche ist das?
„Dieses Land zu verteidigen und zu meiner Familie zurückzukehren, zu meinem Haus, das ich selbst gebaut habe, meinem Garten, den ich selbst angelegt habe.“
Nach seinem ersten Kampfeinsatz kehrte Sonja für drei Tage zurück nach Kyjiw, um sich zum Rettungsassistenten ausbilden zu lassen. Da erfuhr er, dass seine Kampfgenossen bei Bachmut sind, und bat seine Kommandantur, ihn auch dorthin zu schicken. Sie sagten: „Warte, bis wir ein Auto gefunden haben.“ Lange warten musste er nicht.
„Da waren unsere Kämpfer, die brauchten Hilfe, da mussten wir hin“, erklärt er seine Entscheidung, von heute auf morgen an einen der gefährlichsten Hotspots dieses Kriegs zu fahren. „Was, Sorgen? So was hatte ich gar nicht. Nach Charkiw wusste ich ganz genau, was ich kann, ich wollte geradezu in die Schlacht. Einer meiner Kameraden wurde kürzlich verletzt. Das Auto, in dem er saß, wurde aus einem Granatwerfer beschossen. Es hat ihm das Trommelfell zerrissen. Seitdem redet er jeden Tag nur noch davon, wann sein Urlaub endlich vorbei ist und er wieder in den Krieg ziehen kann.“
Ist das schon eine Art Abhängigkeit? Hängt man nach Bachmut quasi „an der Nadel“?
„Ich gebe zu, das hat was von Abhängigkeit. Wenn man mal in einer richtigen Schlacht war, mittendrin, dann kommt einem alles andere fade vor. Das normale Leben wird langweilig. Aber die Hauptmotivation ist nicht die Abhängigkeit, sondern die Pflicht. Du siehst Menschen, die für dich Risiken eingehen, und kannst sie nicht einfach im Stich lassen.”
Sie haben gesagt, Sie haben an vorderster Front gekämpft. Wie ist das so?
„Während der Einsätze arbeitet man schichtweise: vier Tage im Schützengraben, dann genauso lange auf dem Stützpunkt [an einem anderen Ort], wo wir ordentlich essen und uns ausschlafen. An der Front kämpfen wir auf den Wiesen und in den Wäldern rund um Bachmut, ganz nah an den *** [den Russen – Anm. d. Ü]. Wenn wir mit schweren Maschinengewehren schießen, dann bauen wir sie normalerweise auf einem Hügel oder einem befestigten Bunker auf und halten vier Tage die Stellung. Außerdem können wir Drohnen steigen lassen und Ziele erwischen, die hinter den Hügeln in mehreren Kilometern Entfernung liegen.
Meistens sind sechs bis acht Mann in Stellung. Zwei haben Dienst (sehen bei Tageslicht durch die Fernrohre, bei Nacht in die Nachtsichtgeräte), die anderen ruhen. Die Dienste wechseln alle zwei, drei Stunden, weil dann die Konzentration abnimmt. Aber das sind Normen, die nur auf dem Papier existieren, in der Praxis zieht man manchmal auch sechs oder acht Stunden durch.
Ah, und man muss wissen, ich habe eine Eigenart. Sagen wir mal so, ich bin ein bisschen crazy. Ich kann nicht stillsitzen, weil, wie mein Vater immer sagte, der Wolf beißt in die Beine. Wenn wir auf den Posten kommen, dann nehm ich immer einen Batzen Zigaretten mit, gehe zu den ukrainischen Partnern, stelle mich vor, informiere mich über die Lage an der Front und mache mich nützlich, wo ich kann: Die einen brauchen Infos, die anderen Hilfe beim Angriff. Einen Maschinengewehrschützen kann man immer gebrauchen. Und ich hab einen Kurs zum Rettungssanitäter gemacht. Dieses Wissen hab’ ich allerdings nur einmal angewendet, konnte den Mann aber nicht retten. Gross hieß er, war ein Ukrainer. Wurde von einem Hubschrauber aus beschossen und die Lunge getroffen. Ich war in dem Moment ganz in der Nähe. Die Ukrainer hatten keine Evakuierung vorbereitet, also trug ich ihn zusammen mit einem Kameraden eineinhalb Kilometer von der Front weg. Er starb in unseren Armen. Seine Verletzungen waren schwer, es ist uns nicht gelungen, ihn zu stabilisieren. Als wir ihn den Ärzten übergaben, bedankten sie sich, aber ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Gross hat eine Frau und eine kleine Tochter hinterlassen.”
Was haben Sie dann den Rest des Tages gemacht? Geweint?
„Gar nichts. Hab dagesessen, geraucht, geweint.”
Weinen Männer im Krieg oft?
„Natürlich, wir sind ja Menschen und nicht aus Stein.”
In seiner Zeit in Bachmut hat Sonja fünf Kilo abgenommen. Im Unterschied zu seinem Kurzurlaub nach dem ersten Kampfeinsatz hat er diesmal „bei Senat ganze zwölf Tage herausgeschlagen“. Weil er weiß: sein Organismus braucht Erholung.
„Der Großteil des Lebens im Schützengraben sind nicht Angriff und Verteidigung, sondern reines Überleben. Suche nach Essbarem, nach Wärme, nach Möglichkeiten, zu Hause anzurufen oder Tee zu kochen. Das ist alles nicht so schön wie in den Videos, in denen irgendwelche Typen mit MGs auf Sturm gehen und alle niederknallen. Nein. Das ist Dreck, Schmerz, Kälte und Mäuse. Letztere sind unsere größte Plage. Die laufen nachts, wenn man schläft, einfach über einen drüber. Über den Bauch, übers Gesicht. Wir haben versucht, sie zu bekämpfen, aber wenn eine tot ist, kommen drei andere. Das ist Sisyphos-Arbeit. Sie werden von Tag zu Tag größer und fressen unser ganzes Proviant auf, das wir jetzt in Metall- oder Holzkisten aufbewahren müssen. Alles, was in Rucksäcken oder Plastiktaschen ist, erwischen sie, auch wenn das Zeug aufgehängt ist. Einmal hat mich ne Maus sogar vollngekackt, krass, oder? Wer macht denn so was?”
Vergeht die Zeit im Kampf in einem anderen Tempo?
„Es ist alles durcheinander, weil man nicht regelmäßig isst und schläft. Man hat zum Beispiel drei Stunden lang Dienst, dann hat man genauso lang Pause. In diesen drei Stunden muss man es schaffen, zum Bunker zu gehen, zu essen und zu schlafen. Bis man eingeschlafen ist, bleibt nur noch eine Stunde. Bestenfalls, wenn man nicht von einem Geschoss geweckt wird. Dann muss man erst wieder einschlafen. So geht das vier Tage lang. Das Problem ist nicht, dass man nicht schläft, sondern dass man nicht am Stück schläft. Können Sie sich vorstellen, was mit dem Organismus passiert? Dazu kommt noch die unregelmäßige Ernährung und tonnenweise Zigaretten. Am Ende eines solchen viertägigen Einsatzes steht man schon ziemlich neben den Schuhen.
Ich kann es nicht leiden, wenn jemand sagt, die Russen seien miese Kämpfer. Sie sind echte Profis
Um es an der Front halbwegs auszuhalten, versuchen wir, viel zu lachen. Ein Schuss, alle gehen in Deckung, und einer schreit: „Wer hat mir in die Hosen gep…?“ Ohne Humor geht es gar nicht. Wenn du glaubst, du musst das alles bierernst nehmen, drehst du schon nach ein paar Stunden durch.”
Sie kamen im April nach Bachmut, da war es noch recht kalt. Wie ist es denn, unter solchen Bedingungen im Schützengraben oder im Bunker zu sitzen, vor allem nachts?
„Du schläfst in Thermowäsche und komplett angezogen. Über der Kleidung ziehst du die Schutzweste an, und so schlüpfst du in deinen Schlafsack. Nur dass Sie es wissen: Auch jetzt sind die Nächte kalt. Bei meinem letzten Einsatz hatten wir Ukrainer dabei. Deren Kommandeur hatte einen lustigen Kampfnamen: Tomate. Also, Sonja ist noch nicht das Schlimmste. Wobei Tomate ein zwei Meter großer, hartgesottener Frontkämpfer mit grimmiger Miene ist. Ich meinte noch zum Spaß, komm, lass mal klotzen statt kleckern, nennen wir dich gleich Señor Pomidor. Na, und der hatte keinen Schlafsack, also hab ich mich in der Nacht mit ihm in meinen gekuschelt. Blöde Kommentare über Schwule kann man sich sparen. Man muss sich eben irgendwie wärmen, sonst erfriert man.”
Wie würden Sie die Russen als Gegner beschreiben?
„Die Russen sind gut. Ich kann es nicht leiden, wenn jemand sagt, die Russen seien miese Kämpfer. Sie sind echte Profis. Am Anfang vielleicht nicht so, aber jetzt haben sie den Dreh raus. Wenn ich gefragt werde, wieso wir sie nicht plattmachen, dann sage ich: ,Komm doch selber und mach sie platt.‘
Während meines Einsatzes sind wir in einem Monat zwei Kilometer vorangekommen. Rechnen Sie sich mal aus, wie lang wir da bis zur Krim brauchen? Hören sie nicht auf diese ***, die behaupten, dass die Russen nichts anderes können, als Kanonenfleisch zu verpulvern. Ich sehe es ja mit eigenen Augen: Sie können kämpfen, sie können mit Drohnen umgehen, und ihre Stellungen halten können sie auch. Genug Waffen und Munition haben sie auch, also hört auf, auf einen schnellen Sieg zu hoffen.”
Reden wir mal von etwas Positivem: Sie sind jetzt im Urlaub, wie ist es denn, nach zweieinhalb Monaten in Bachmut ein relativ friedliches Leben zu führen?
„Am ersten Tag hab’ ich mich in der Parfümerie verirrt. Ich brauchte eine stoßfeste Hülle für mein Tablet. Und neben dem Haus, in dem ich für die paar Tage eine Wohnung gemietet habe, gibt es ein großes Einkaufszentrum. Eine Freundin und ich gingen rein, und da waren lauter Spiegel, alles glänzte – ich war komplett verloren. Ich wusste nicht mehr, wo ich war, hatte ja vor 20 Stunden gerade noch im Schützengraben gehockt. Ich laufe, so bilde ich mir ein, durch den Elektronikladen und finde nirgendwo eine Hülle. Irgendwann stupst mich meine Freundin an und fragt: ,Brauchst du irgendwas von hier?‘ – ,Was meinst du?‘, frage ich verwirrt, seh mich um und checke, dass ich zwischen Lippenstiften und Wimperntusche eine Tablethülle suche. Ich hab´ irgendeinen Spruch gerissen, und wir sind raus. Aber insgeheim dachte ich, wie sehr ich doch neben der Spur sein muss, wenn ich Parfümerie mit Elektronik verwechsle. Das macht mir schon Angst.”
Was werden Sie nach dem Krieg als Erstes tun?
„Wenn ich überlebe? Ich gehe zurück nach Belarus. Ich hab’ mir dort ein Haus gebaut, mit Grundstück und Garten. Ich pflanze noch ein paar Bäume und hisse eine Flagge, nein zwei – eine belarussische und eine ukrainische. Das steht mir zu, ich hab´ ja gekämpft. Und dort lebe ich dann. Ich möchte Jäger werden, die Tiere schützen, das hat mir mein Vater beigebracht. Und mir eine Frau suchen, eine junge, hübsche. Wissen Sie, eine, wo sich die anderen Männer umdrehen, wenn ich mit ihr die Straße langgehe. Und Kinder will ich haben. Das sind natürlich lauter Fantasien, aber träumen schadet ja nicht?”
Wieder im Kindergarten arbeiten wollen Sie nicht?
„Vielleicht auch das.”
Weitere Themen
In einem Land zwischen Wald und Fluss
Wenn Lukaschenko plötzlich stirbt