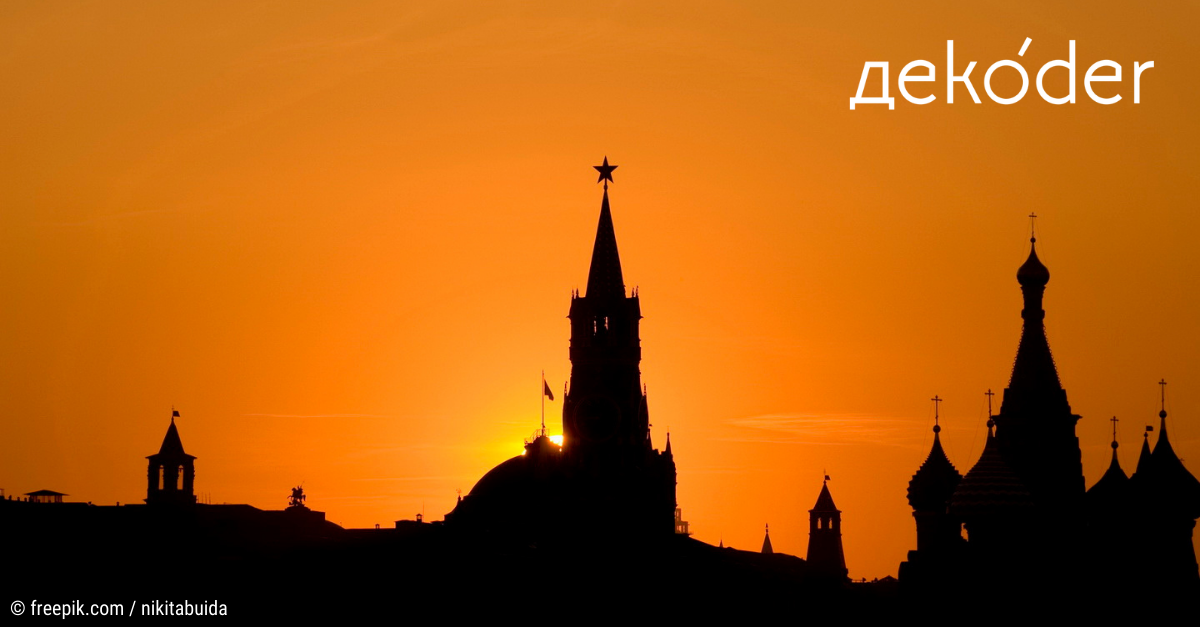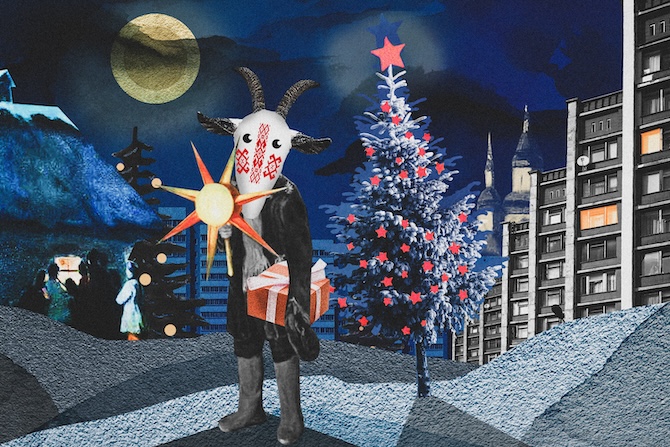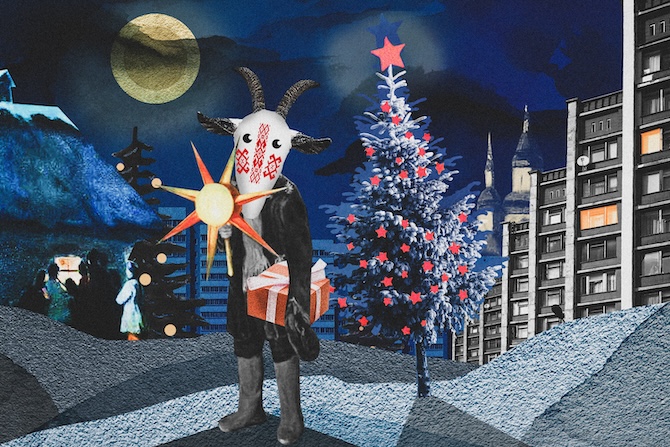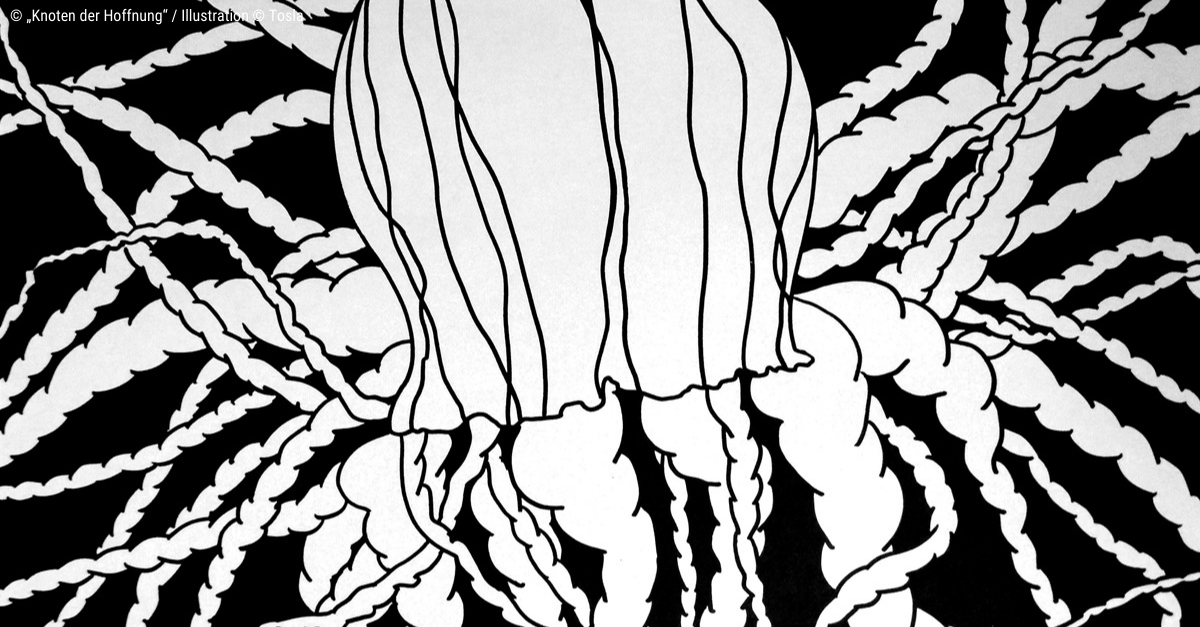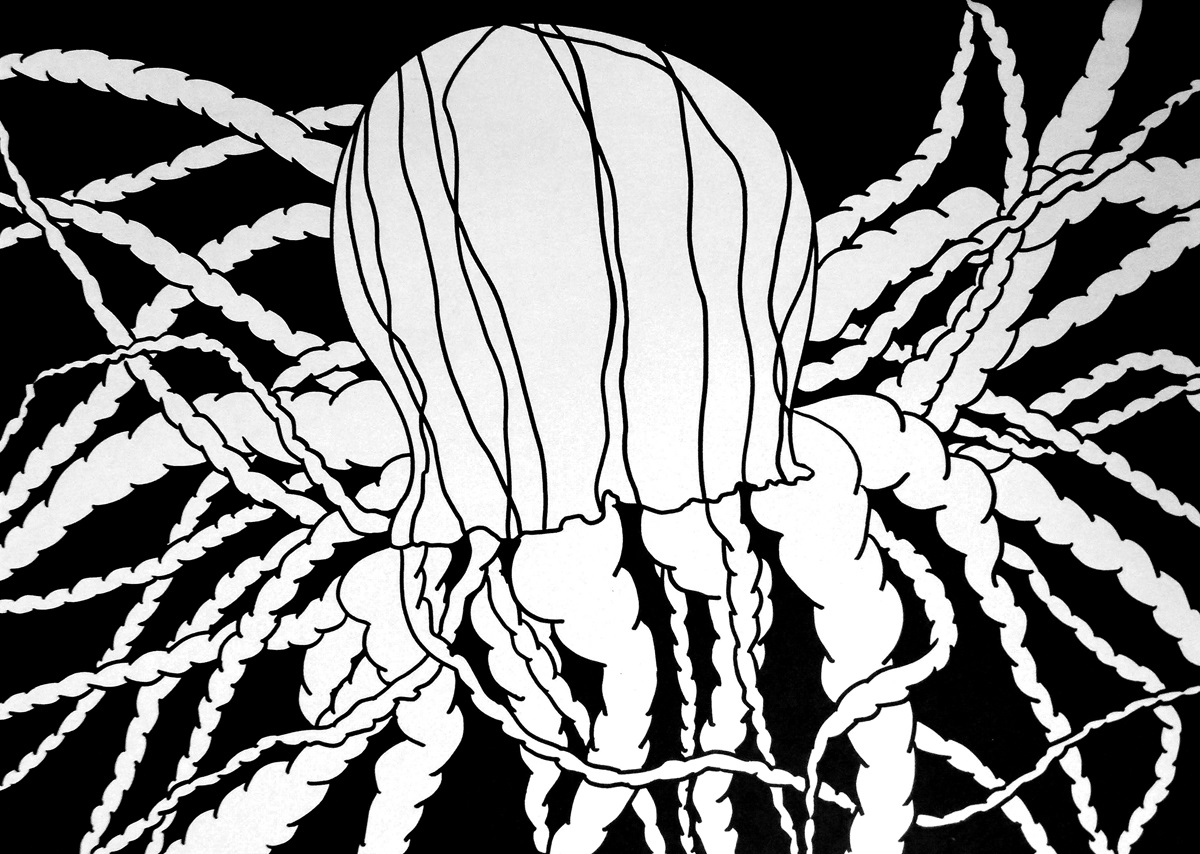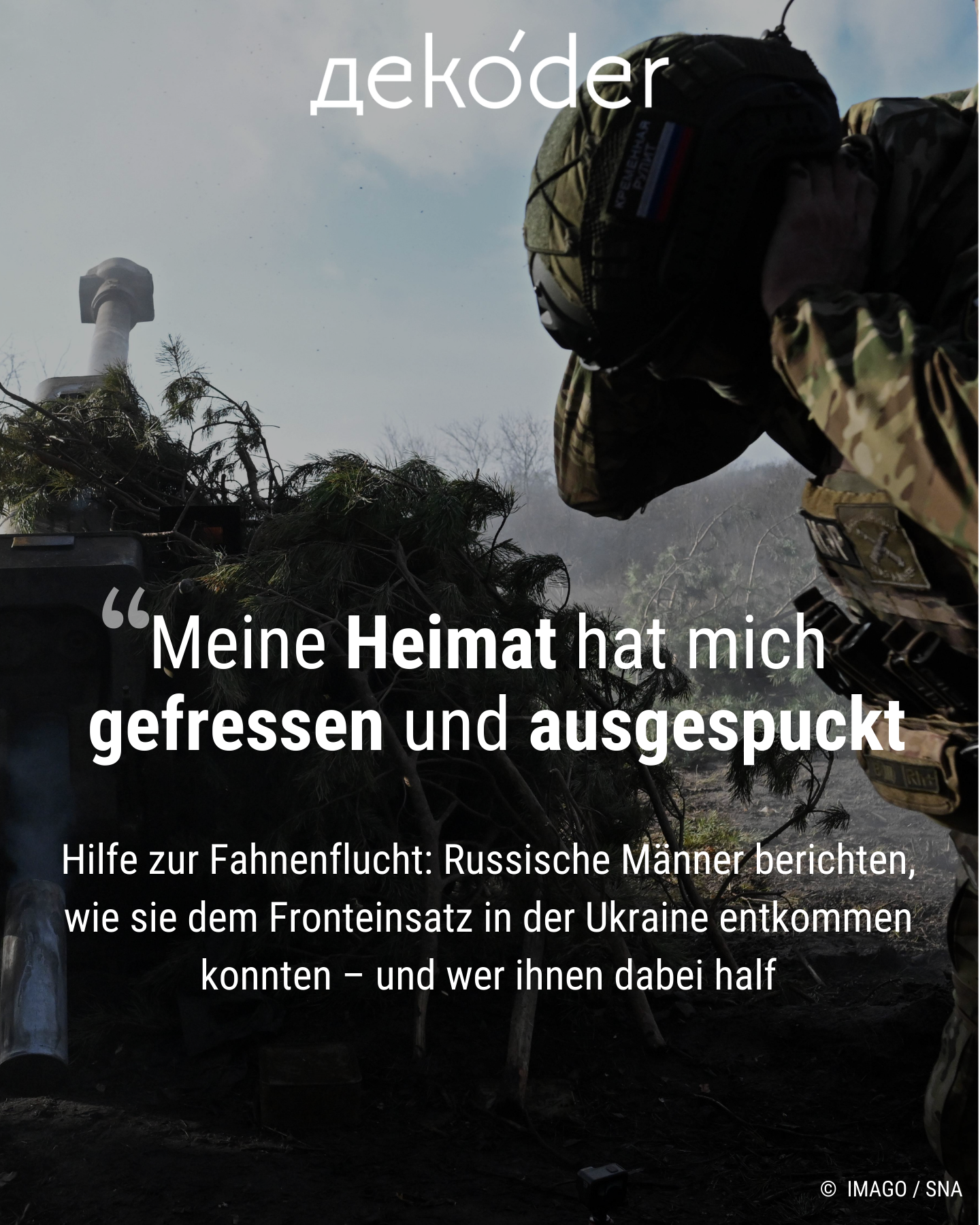Zehntausende Belarussen wurden nach den Ereignissen im Jahr 2020 Opfer von Repressionen und Verfolgungen, Hunderttausende haben aus Angst und Perspektivlosigkeit das Land verlassen. Auch der russische Krieg gegen die Ukraine beeinflusst die Stimmung in der belarussischen Gesellschaft. Eine Studie hat genau die untersucht. Sie zeigt, dass die Konfrontation zweier nationaler Ideen kritische Formen annimmt und einen Dialog zwischen Vertretern dieser polarisierten Gruppen praktisch unmöglich macht. Das Online-Medium Reform.by hat sich die Studie angeschaut. Hier die wichtigsten Ergebnisse.
Die Studie Belarussische nationale Identität im Jahr 2023 wurde im November von unabhängigen Soziologen mithilfe der Friedrich-Ebert-Stiftung erstellt. Die Daten wurden mittels einer Online-Umfrage erhoben, bei der die Fragebögen von den Befragten selbst ausgefüllt wurden (Computer Assisted Web Interviewing – CAWI). An der Umfrage nahmen 1205 Personen aus belarussischen Städten mit über 20.000 Einwohnern teil. Die Stichprobe ist hinsichtlich von Geschlecht, Alter und Bildungsstand repräsentativ.
Die Soziologen stellen fest, dass die politische Krise, die 2020 in Belarus einsetzte, weiterhin die Lage im Land beeinflusst. Hinzu kommen der russisch-ukrainische Krieg und weltpolitische Veränderungen. Die Menschen in Belarus sind durch eine ganze Reihe von Ansichten polarisiert, eine zentrale ist dabei die nationale Identität. Diese wurde für viele zu einem Prisma, durch das die Bewertung des aktuellen Geschehens und der Zukunft des Landes erfolgt.
Zwei nationale Projekte
In Belarus existieren heute zwei konkurrierende nationale Projekte, die von Wissenschaftlern als russisch-sowjetisch bzw. als nationalromantisch beschrieben werden. Das erste greift auf das sowjetische Erbe zurück, ist auf Russland ausgerichtet und stellt den Staat als nationsbildende Institution in den Vordergrund. Das zweite ist eher proeuropäisch, bezieht sich auf die vorsowjetische Geschichte und betrachtet die belarussische Kultur als wesentliches Element der Nation. Der Kampf und die Wechselbeziehungen dieser Projekte wie auch der Einfluss der gegenwärtigen Identität Russlands, des Kosmopolitismus und national indifferenter Haltungen bestimmen die Besonderheiten der nationalen Identität der Belarussen.
An den äußeren Identitätspolen sind zwei Gruppen angesiedelt, die „[National]bewussten“ (13 Prozent) und die „Sowjetischen“ (37 Prozent). Erstere engagieren sich für einen nationalromantischen Entwurf und orientieren sich an der belarussischen Kultur und Sprache sowie an der vorsowjetischen Geschichte des Landes. Für sie sind nationale Symbole und bedeutsame Gedenkdaten wichtig, etwa das Pahonja-Wappen, die weiß-rot-weiße Flagge, volkstümliche und geschichtsbezogene Feiertage wie der Jahrestag der Ausrufung der Belarussischen Volksrepublik.
Die Gruppe der „Sowjetischen“ hängt – wie der Name schon sagt – einer Vorstellung an, die sich auf das russisch-sowjetische Imperium, das Erbe der belarussischen Sowjetrepublik und die Nähe zu Russland bezieht. Angehörige dieser Gruppe vertreten die Vorstellung von der Dreieinigkeit einer [ost]slawischen Nation. Zu ihren Symbolen und Gedenktagen gehören die rot-grüne Flagge, Staatsunternehmen, die Paraden [zum offiziellen Unabhängigkeitstag – dek] am 3. Juni und [zum sowjetischen Tag des Sieges – dek] am 9. Mai.
Zwischen diesen beiden Polen liegen die Gruppen der „sich Entwickelnden“ (19 Prozent), der „Gleichgültigen“ (27 Prozent) und der „Russifizierten“ (4 Prozent). Für die „sich Entwickelnden“ sind die Merkmale beider Nationalideen kennzeichnend, sowie ein beträchtliches Interesse an globaler Identität und Multikulturalität. In diesem Segment gibt es viele junge Leute, oft mit einem guten Bildungsniveau. Die „Gleichgültigen“ hingegen sind praktisch kaum in den nationalen Projekten involviert und ihr Bildungsgrad ist beträchtlich geringer. Die „Russifizierten“ schließlich halten sich schlichtweg für Russen, und nicht für Belarussen.
Linien der Spaltung
Abhängig vom Grad des Vertrauens in staatliche und nichtstaatliche Strukturen und Gruppen in der belarussischen Gesellschaft haben die Soziologen hier vier Bereiche eines sozialen Konflikts identifiziert. Zwei von ihnen befinden sich an den Polen der politischen Konfrontation: Es sind die „überzeugten Gegner“ der derzeitigen Regierung und deren „überzeugte Anhänger“.
Die „überzeugten Regierungsgegner“ machen 10 Prozent aus. Für sie ist einerseits ein hohes Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und Gruppierungen kennzeichnend, und andererseits ein Vertrauen zu nichtstaatlichen Strukturen. Die „überzeugten Regierungsanhänger“ belaufen sich auf 23 Prozent. Und hier ist es genau umgekehrt: Sie vertrauen staatlichen Strukturen und misstrauen nichtstaatlichen Akteuren.
Gleichzeitig habe sich – so die Soziologen – im Laufe des letzten Jahres die Anzahl der „überzeugten Regierungsgegner“ beträchtlich verringert, während die der „überzeugten Regierungsanhänger“ gestiegen ist. Zwischen diesen beiden Gruppen liegen zwei gemäßigtere. Das sind einerseits die „gemäßigten Regierungsgegner“ (28 Prozent). Diese ist die am stärksten zentristische Gruppe, die weder den staatlichen noch den nichtstaatlichen Strukturen groß vertraut. Wenngleich sie dazu neigt, eher den letzteren Vertrauen entgegenzubringen. Die Soziologen stellen fest, dass diese Gruppe in wesentlich geringerem Maß mit der Agenda der demokratischen Bewegung in Berührung kommt. Es wird für die Bewegung ein harter Kampf werden, Vertreter dieser Gruppe auf ihre Seite zu ziehen.
Wie sind also die Wechselbeziehungen zwischen den politischen und wertebezogenen Gruppen und die Haltung der Anhänger und Gegner der Regierung zu den beiden Ideen, der nationalromantischen und der russisch-sowjetischen? Wir sehen deutlich, dass die „überzeugten Regierungsanhänger“ hauptsächlich aus „Sowjetischen“ bestehen (69 Prozent), während die „überzeugten Regierungsgegner“ über die Hälfte „[National]bewusste” sind.
Dabei verweisen die Soziologen darauf, dass der Anteil [in Bezug auf die nationale Idee] von „Gleichgültigen“ angestiegen sei, und zwar unter den „gemäßigten Regierungsanhängern“ wie auch bei den „gemäßigten Gegnern“ [der Regierung]. Bei denen, die der aktuellen Regierung vertrauen, betrug der Anstieg 12 Prozentpunkte. Bei jenen, die nichtstaatlichen und oppositionellen Strukturen vertrauen, waren es 14 Prozentpunkte. Was bedeutet, dass die politischen Gruppen und die Identitätsgruppen eng zusammenhängen. Dies ist auch am Grad des Vertrauens in staatliche und nichtstaatliche Strukturen erkennbar.
Doch insgesamt halten die Soziologen fest: 2023 ist das Vertrauen in staatliche Strukturen und Gruppierungen im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen. Das Vertrauen in sämtliche nichtstaatliche Strukturen hingegen ist deutlich zurückgegangen: Weniger als ein Drittel der Befragten ist geneigt, ihnen zu vertrauen. Gleichzeitig hat sich im Laufe des Jahres der Anteil „der überzeugten Regierungsgegner“ beträchtlich verringert und der „überzeugten Regierungsanhänger“ erhöht.
Hervorzuheben sind auch erhebliche Unterschiede zwischen „überzeugten Regierungsanhängern“ und „gemäßigten Regierungsanhängern“ hinsichtlich des Vertrauens in staatliche Organisationen und Institutionen. Das betrifft das Vertrauen in die staatlichen Medien und in die Beamtenschaft: Die „Gemäßigten“ bringen ihnen in erheblich geringerem Maße Vertrauen entgegen. Zudem äußert über die Hälfte der „gemäßigten Regierungsanhänger“ ein Misstrauen gegenüber nichtstaatlichen Strukturen. Am häufigsten werden dabei nichtstaatliche Medien genannt sowie Menschen, die aus Angst vor Repressionen das Land verlassen haben, und jene, die die Wahlergebnisse von 2020 nicht anerkennen.
Naturgemäß unterscheiden sich die Gruppen der „[National]bewussten” und der „Sowjetischen“ am stärksten voneinander. Im Grunde wiederholt sich hier das gleiche Muster wie bei den „überzeugten Regierungsgegnern“ und „überzeugten Regierungsanhängern“. Die „[National]bewussten” vertrauen in höherem Maße allen nichtstaatlichen Strukturen und vertrauen staatlichen Institutionen seltener. Die „Sowjetischen“ hingegen vertrauen staatlichen Strukturen in sehr hohem Maße und wesentlich seltener nichtstaatlichen oder oppositionellen Stellen. Für die „gemäßigten Regierungsgegner“ wiederum ist ein gleich großes Vertrauen gegenüber beiden Strukturen typisch.
Die Lage könnte wegen des Krieges und der Sanktionen nämlich beträchtlich schlechter sein. Das wird auch den Leistungen der Regierung zugeschrieben
Was ist der Grund für das gewachsene Vertrauen gegenüber staatlichen Institutionen? Einer der Autoren der Studie, der Soziologe Filipp Bikanow, ist der Ansicht, dass hier ein ganzes Bündel von Faktoren bestimmend sei. Zum einen wäre da der Konsens gegen den Krieg: Die Mehrheit ist überzeugt, dass sich die belarussische Armee so weit wie möglich aus dem russisch-ukrainischen Krieg heraushalten sollte. Und die Regierung unterstützt diese Haltung zumindest verbal. Zweitens steigt der Lebensstandard der Belarussen zwar nicht rapide, er sinkt aber auch nicht katastrophal. Und die Menschen spielen gedanklich verschiedene Szenarien durch – denn die Lage könnte wegen des Krieges und der Sanktionen beträchtlich schlechter sein. Das wird auch den Leistungen der Regierung zugeschrieben.
Bikanow nimmt an, dass das Jahr 2020 für viele schon der Vergangenheit angehört. Und alle, die nicht zur Gruppe der „überzeugten Regierungsgegner“ zählen, leben ihr eigenes, gewohntes Leben weiter. Aber auch die erzwungene Emigration sollte nicht außer Acht gelassen werden: Viele, die der Regierung nicht trauten und nicht trauen, haben das Land verlassen, was die Ergebnisse der Studie beeinträchtigt.
Informationskokon
Ein weiterer Faktor, den Bikanow anführt: Die meisten Belarussen befinden sich heute im Informationsraum der staatlichen belarussischen und der russischen Medien. Die Konfliktparteien leben in unterschiedlichen medialen Blasen: Die „überzeugten Regierungsanhänger“ sind hauptsächlich Konsumenten der staatlichen Medien, während die „überzeugten Regierungsgegner“ vorwiegend nichtstaatliche Medien nutzen.
Das ergibt sich aus der Säuberung des Mediensektors: In den vergangenen drei Jahren hat die Regierung der Bevölkerung den Zugang zu unabhängigen Medien aktiv versperrt, besonders zu jenen, die über Politik berichten. Gleichzeitig werden verstärkt die eigenen und die russischen Narrative verbreitet, die – das sehen wir jetzt – höchst destruktive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben.
Mangel an Empathie
Ein Aspekt der Studie verdient besondere Aufmerksamkeit. Hier gibt es Grund zur Sorge.Die Studien vergangener Jahre haben gezeigt, dass die „überzeugten Regierungsanhänger“ und die „überzeugten Regierungsgegner“, die höchst unterschiedliche Ansichten zur Weiterentwicklung des belarussischen Staates haben, eine starke gegenseitige Abneigung hegen. Diese geht so weit, dass Kontakt vermieden wird. Dabei blieb diese Frage jedoch unbeantwortet: Wie tief geht diese Abneigung, und betrifft sie nur die politischen Meinungsunterschiede?
Die Forscher wollten überprüfen, wie schwer es Anhängern und Gegnern der Regierung fällt, Empathie und Mitgefühl für politische Opponenten zu bekunden. Empathie wurde in dieser Studie als Verständnis für das Unglück eines anderen Menschen definiert, und als Einfühlungsvermögen aus dem Bedürfnis heraus, die Leiden des Anderen vermindern zu wollen.
Es scheint, dass die Vertreter der beiden politischen Pole in geringerem Maße bereit sind, mit jemandem mitzufühlen, der in eine schwierige Lage geraten ist, wenn dieser der jeweils anderen Gruppe angehört. Das gilt übrigens unabhängig von der Art der schwierigen Situation, sei es eine politisch motivierte Entlassung oder eine Alltagssituation wie eine Erkrankung.
Mit der Zeit wird es immer schwieriger werden, auf einen konstruktiven Dialog zwischen den beiden Polen zu hoffen
Die Soziologen konstatieren, dass die gesellschaftspolitische und identitätsbezogene Spaltung auch von einer psychologischen unterfüttert wird. In dieser Hinsicht bilden die Vertreter der „überzeugten Regierungsgegner“ und der „überzeugten Regierungsanhänger“ die Protagonisten dieses heftigen gesellschaftlichen Konflikts. Sie zeigen die geringste Empathie füreinander. Auch wenn sie den eigenen Leuten gegenüber sehr empathisch sind. Wobei die „überzeugten Regierungsgegner“ sowohl gegenüber den Eigenen wie auch gegenüber einer außenstehenden Gruppe etwas empathischer sind als die „überzeugten Regierungsanhänger“.
Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass ein Dialog zwischen den beiden Gruppen praktisch unmöglich ist. Die „überzeugten Regierungsanhänger“, die ihre Gegner nicht verstehen, werden wohl dazu neigen, den „Fremdlingen“ sofort mit Aggression zu begegnen. Und die „überzeugten Regierungsgegner“, bei denen die Unterstützung für die eigenen Leute am größten ist, und die zusammenhalten, wenn sie angegangen werden, sehen sich genötigt, bei ihrem Kurs zu bleiben und sich zu verteidigen.
Die gemäßigten Gruppen sind erheblich empathischer gegenüber Menschen mit gegenteiligen Standpunkten. Somit ist ein aktiver gesellschaftlicher Dialog anscheinend nur zwischen den Gemäßigten möglich, weil sie ungefähr in gleichem Maße mit der eigenen und der anderen Gruppe mitfühlen. Gleichzeitig äußern auch die „Sowjetischen“ und “die „[National]bewussten” – ganz wie die „überzeugten Regierungsgegner“ und die „überzeugten Regierungsanhänger“ – gegenüber einer fremden Gruppe weniger Mitgefühl, Verständnis und empathische Regungen.
Die Polarisierung der belarussischen Gesellschaft beunruhigt die Soziologen. Das Vorgehen der Regierung und ihrer Propagandisten, das die Belarussen auseinanderbringen soll, bleibt nicht ohne Wirkung. Dadurch wird die identitätsbezogene Konfrontation der beiden nationalen Ideen zu einem Faktor, der sogar auf der Empathie-Ebene wirkt.
In Belarus sind zwei unversöhnliche Lager entstanden. Für die „sowjetischen“ Anhänger der Regierung würden politische Veränderungen ebenso ein Trauma bedeuten, wie die aktuelle Stagnation und die Repressionen für die „[National]bewussten” und die Verfechter der nationalromantischen Idee ein Trauma darstellen. Diese Eisschollen werden wohl weiter auseinanderdriften. Mit der Zeit wird es immer schwieriger werden, auf einen konstruktiven Dialog zwischen den beiden Polen zu hoffen. Die Lösung dieses Problems wird wohl eine der wichtigsten Aufgaben sein, die die derzeitige Situation im Land für die gesamte Gesellschaft ergibt. Die Frage ist äußerst weitreichend: Schließlich könnte die ideologische Konfrontation der beiden nationalen Ideen sehr wohl blutig enden.
Weitere Themen
„Wir sollten keine Feinde sein“
Meinst du, die Belarussen wollen Krieg?
Unter dem Einfluss der russischen Welt
„Uns steht noch so etwas wie ein Bürgerkrieg bevor”
„Als würde sich alles in einer anderen Realität abspielen – wie im Traum”