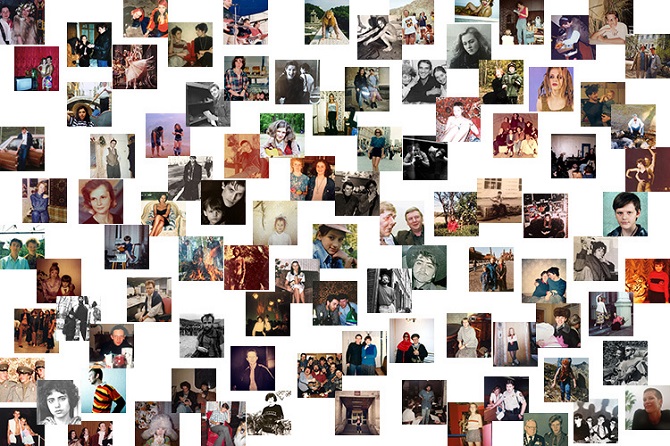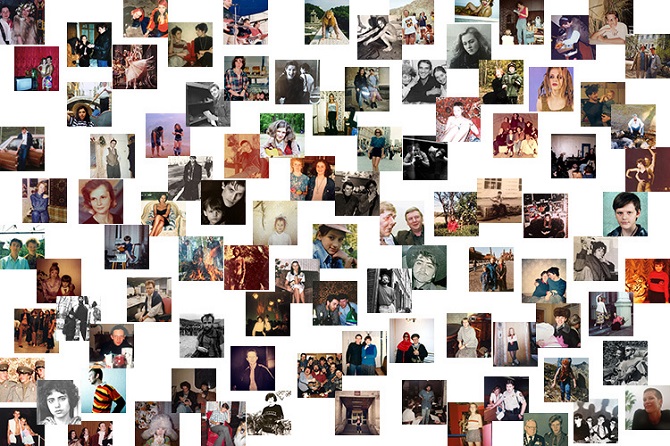Kontrovers diskutiert im russischen Internet wird derzeit dieses Interview mit Alexander Baunow zum Thema Syrien. Baunow schreibt als Journalist in verschiedenen unabhängigen Medien vor allem über außenpolitische Themen, zuvor war er mehrere Jahre im diplomatischen Dienst der Russischen Föderation tätig. Seit 2015 ist er zudem senior associate des Carnegie Center Moskau, eines international aufgestellten Thinktanks. Die Fragen an Alexander Baunow stellte für Colta.ru Arnold Chatschaturow.
Das Interview hat vor allem in regierungskritischen Kreisen skeptische Reaktionen hervorgerufen, da Baunow aus einer relativ regierungsnahen Perspektive argumentiert. Insbesondere wurde eine Tendenz zur Verharmlosung der Repressionen und Menschenrechtsverletzungen durch das Regime Assad schon in der Zeit vor dem Bürgerkrieg beklagt sowie ein ungenügendes Hinterfragen der tatsächlichen Ziele der russischen Luftschläge. Andererseits hat das Material Beifall erhalten dafür, dass es nicht der Versuchung erliegt, jegliches außenpolitische Handeln des Kreml reflexhaft zu verurteilen: Baunow sieht in Russlands Syrien-Einsatz einen durchaus sinnvollen Versuch, nach der Ukraine-Krise wieder einen Dialog mit dem Westen anzubahnen – der seinerseits zunächst abwartend beobachte, ob man Russland diesmal vertrauen könne.
Keine zwei Tage nach Wladimir Putins Rede vor der UN-Generalversammlung [am 28. September – dek] hat Russland die ersten Luftschläge in Syrien ausgeführt. Die Frage ist allerdings, gegen wen?
Die russische wie die syrische Führung versichern, dass die Luftschläge sich gegen den Islamischen Staat richten. Die syrische Opposition erklärt, sie selbst und die Zivilbevölkerung seien das Ziel der Angriffe. Allerdings ist für die Opposition ein Szenario, in dem Russland Assad hilft, in jedem Fall ein Alptraum: Selbst wenn die Intervention sich tatsächlich nur gegen den IS richtet und die Opposition in keiner Weise tangiert, stärkt das indirekt Assad, weil es ihn an einer der Fronten entlastet, und nimmt der Opposition die Chance auf einen klaren Sieg. Deshalb ist sie daran interessiert, die Sache von Anfang an so darzustellen, als würde Russland sie bekämpfen. Jede Seite verfolgt ihre eigenen Interessen, man kann also niemandem ohne weiteres glauben, sondern muss abwarten, bis Beweise vorliegen. Wären die Informationen über diese Luftschläge von OSZE-Beobachtern gekommen – die es in Syrien natürlich nicht gibt –, oder auch, sagen wir, von Frankreich, dann könnte man ihnen viel eher vertrauen.
Der zweite Punkt ist, dass der IS kein Staat mit festen Grenzen ist, sondern eine Organisation, die sich selbst zum Kalifat erklärt hat. Auf den Karten, die wir in den Medien sehen, sind die Gebiete, die Russland am Mittwoch bombardiert hat, nicht in den IS-Farben dargestellt. Die Lage vor Ort ist viel komplizierter, und eine einzelne Einheit von Kämpfern in irgendeinem Dorf ist in diesen Karten nicht zwangsläufig erfasst. Um das zu wissen, braucht man kein Syrien-Spezialist zu sein, es genügt, sich an den russischen Bürgerkrieg zu erinnern: Auch damals gab es bis auf wenige Ausnahmen keine geschlossenen Territorien.
Jede Seite verfolgt ihre eigenen Interessen, man kann also niemandem ohne weiteres glauben, sondern muss abwarten, bis Beweise vorliegen.
Die dritte Frage ist, wen außer dem IS es in Syrien noch gibt und ob alle übrigen Kräfte tatsächlich der vielzitierten demokratischen Opposition angehören, die in Wirklichkeit weniger eine demokratische als eine sunnitische Opposition ist. Die New York Times zum Beispiel schreibt, die russischen Luftschläge hätten Stellungen der Al-Nusra-Front zum Ziel gehabt. Aber diese Al-Nusra-Front ist ein Ableger von Al Qaida, und sie hat schon zu einer Zeit, als der IS noch nicht in Syrien agierte, in der christlichen Stadt Maalula im Südwesten des Landes – einem einzigartigen Ort, wo bis heute Aramäisch gesprochen wird – ein Massaker angerichtet. So eine Gräueltat steht denen des IS in nichts nach. Sollten Stellungen der Al-Nusra von den Luftschlägen getroffen worden sein, muss man also sagen, das haben sie verdient.
Warum hat man für die Luftschläge keine eindeutig zuzuordnenden Gebiete gewählt?
Hätte man sich vor allem aus Imagegründen oder zu diplomatischen Zwecken zu bombardieren entschlossen, dann hätte man sich andere Ziele suchen müssen, in einem homogeneren Teil der Karte. Es gibt dort ja Wüsten, Oasen, Flusstäler, und die detaillierten Karten zeigen ein wesentlich komplexeres Bild. Ich denke, bei der tatsächlichen Auswahl der Ziele haben drei Überlegungen den Ausschlag gegeben. Zum einen bombardieren die amerikanischen Bündnispartner den IS schon seit einem Jahr, sie haben schon tausende Einsätze geflogen, insofern wäre es gar nicht so einfach, hier noch ein eigenes Ziel zu finden. Zweitens war natürlich klar, dass die sonderbare Warnung an die Amerikaner, sie sollten ihre Flüge einstellen, keine Wirkung haben würde, so dass die russische Luftwaffe womöglich gleichzeitig mit der amerikanischen, britischen oder türkischen über IS-Gebiet geflogen wäre. Und da Russland sein Vorgehen auf taktischer Ebene bisher nicht abgestimmt hat (auch wenn sich das bald ändern dürfte), wäre das nicht ungefährlich gewesen.
Wenn ein Land nicht frei ist, folgt daraus, dass wir schleunigst für den Sturz des dortigen Regimes sorgen müssen? Oder sollten wir erst einmal sehen, wer dieses Regime ablösen könnte?
Drittens schließlich gab es eine Gruppe von Zielen, die die westliche Koalition grundsätzlich nicht angegriffen hat. Das von der syrischen Regierung kontrollierte Gebiet beschränkt sich ja zum einen auf Damaskus und Umgebung, zum anderen auf die Küste mit den Ausläufern des Libanon-Gebirges, von Tartus über Latakia in Richtung des türkischen Antakya. Die wichtigste Straße dazwischen führt durch sunnitisches Gebiet, an ihr liegen die Städte Homs und Hama, und zwischen diesen Städten wiederum lagen die Ziele der gestrigen Luftschläge. Wir reden hier also von der einzigen Straße, die die beiden von der Regierung kontrollierten Landesteile verbindet. Wenn diese Verbindung abgeschnitten wird, zerfällt das Gebiet in zwei Teile. Das würde Assad schwächen, er wäre viel leichter zu besiegen. Die Ziele, die die syrische Armee Russland gegenüber benannt hat, sind folglich lebenswichtige Punkte.
Über die syrische Opposition herrscht viel Unklarheit. Gibt es überhaupt neutrale Gruppen in ihren Reihen, oder ist sie durchweg islamistisch?
Was und wer die syrische Opposition ist, das ist ein Thema für sich. Die Revolution im Iran wurde von Kommunisten, liberalen Demokraten, antiwestlicher Intelligenzia, Studenten und Islamisten gemeinsam gemacht. Die stärkste Gruppe waren am Ende die Islamisten. Ähnlich verhält es sich auch in Syrien: Der Teil der Bevölkerung, der Assad sein Vertrauen entzogen hat, setzt sich aus ganz verschiedenen Gruppen zusammen, aber die stärkste Kraft unter ihnen sind die Islamisten. Und auch diese Gruppe ist in sich wieder sehr heterogen – das Spektrum reicht von relativ gemäßigten Organisationen wie der Muslimbruderschaft bis zur Al-Nusra-Front, die schon ganze Städte abgeschlachtet hat. Natürlich sind die gebildeten Männer in westlichen Anzügen, die vor die Fernsehkameras treten und die Losungen der Opposition proklamieren, nur die mediale Seite des Widerstands – vor Ort laufen Männer in ganz anderen Anzügen und mit Maschinenpistolen herum. Andererseits sind ja auch die Vertreter der Assad-Regierung europäisch gekleidete, weltliche Männer und Frauen ohne Kopftuch – vergessen wir nicht, dass Syrien schon seit einem halben Jahrhundert eine säkulare Diktatur ist.
Die gesamte westliche Welt wendet sich heute gegen die syrische Staatsführung. Welche politischen Perspektiven hat Assad Ihrer Meinung nach, genießt er im Volk noch Vertrauen?
Ich bin selbst weniger als ein Jahr vor Ausbruch des Bürgerkriegs in Syrien gewesen, und ich kann sagen, dass die Entwicklung damals nicht vorherzusehen war. Von einer maroden Diktatur, die kurz vor dem Fall steht, von einem beim Volk verhassten Schreckensregime war nichts zu spüren, diese Stimmung gab es nicht. Es gab sie in Libyen, und es gibt sie heute im Iran, aber in Syrien gab es einen damals noch jungen Diktator (er ist auch heute noch ziemlich jung), an den sich Hoffnungen knüpften – und er hat ja auch wirklich eine gewisse Liberalisierung in Angriff genommen, vor allem im Bereich der Wirtschaft. Er hatte in London gelebt, dort studiert und als Arzt gearbeitet. Er war kein Isolationist, im Gegenteil: Die Regierungszeit des jüngeren Assad verbindet man mit einem vorsichtigen Umbau des arabischen Sozialismus zu einer zunehmend weltoffenen Marktwirtschaft. Damaskus Anfang der 2000er und Anfang der 2010er Jahre, das waren zwei völlig verschiedene Städte, und auch das Land insgesamt hatte sich verändert. Auf einmal gab es private Initiativen, es gab westliche Hotels, Restaurants, Handel – noch kein Starbucks Café, aber weit weg war auch das nicht mehr.
Im Bezug auf die Ukraine wurde eine Unmenge von Mythen in die Welt gesetzt – in Bezug auf Syrien ist das anders. Hier konstruieren beide Seiten ihre Realität etwa im selben Maß.
Das Wesen eines Regimes ist ja nicht das einzige, was zählt, man muss auch sehen, in welche Richtung es sich entwickelt. Das syrische Regime war vor dem arabischen Frühling dabei, sich zu liberalisieren, und eben deshalb hat es sich als so stabil erwiesen. Ben Ali war innerhalb von zwei Wochen weg vom Fenster, bei Mubarak dauerte es gerade einmal sechs Wochen, Gaddafi konnte sich vier Monate halten, und das auch nur, weil er die Hauptstadt verließ und sich ins Gebiet seines Clans zurückzog. In Syrien geht der Bürgerkrieg in sein fünftes Jahr. Ein blutiger Tyrann, der in einem Bürgerkrieg fünf Jahre lang die Hauptstadt kontrolliert, wird offensichtlich nicht nur von seinem eigenen Geheimdienst unterstützt, sondern auch noch von anderen Kräften. Hinter ihm stehen zumindest die 30 Prozent der Bevölkerung, die religiösen Minderheiten angehören: Sie sehen durch Assads Herrschaft ihr Überleben gesichert. Dazu kommt ein Teil der Sunniten, die ja auch nicht alle unter der Scharia leben wollen. Die Entscheidung zwischen der Scharia und einer säkularen Diktatur fällt nicht zwangsläufig zugunsten der ersteren aus. Es gab schließlich auch Afghanen, die die sowjetische Herrschaft der der Taliban vorzogen. Mich wundert das überhaupt nicht. Umfragen zufolge (wie genau deren Ergebnisse in Syrien derzeit sein können, ist natürlich schwer zu sagen) unterstützt etwa ein Viertel der syrischen Bevölkerung den IS.
Warum hat sich die westliche Koalition dann so auf Assad eingeschossen?
Das ist sehr die Frage. Ich vermute, die Vorgeschichte war in etwa die: Als erstes wurde Ben Ali abgesetzt – ein säkularer Diktator und prowestlicher Politiker, dann Mubarak, ebenfalls ein Partner des Westens, dann Gaddafi, der dem Westen verhasst war, aber gerade in seinen letzten Jahren angefangen hatte, die Beziehungen zum Westen zu normalisieren und westliche Ölfirmen ins Land zu lassen. Damals hatte man das Gefühl, auch Assad würde nicht mehr lang im Amt bleiben. Warum sollte man ihn also nicht stürzen? Syrien hatte ja fünfzig Jahre lang zum antiwestlichen Lager gehört, es war eher mit der Sowjetunion und dem Iran verbündet, der dem Westen gleichfalls eher unangenehm war. Aber die Wette auf den friedlichen Wandel ging nicht auf. Und im nächsten Schritt setzte die Dynamik der Verstrickung ein: Nachdem es nicht gelungen war, Assad mit Hilfe friedlicher Demonstrationen zu stürzen, nachdem Assad diese Demonstrationen gewaltsam niederzuschlagen begonnen hatten, musste man eben auf anderen Wegen helfen. Wenn man ständig in eine Partei eines Konflikts investiert, diese Seite aber nicht siegt, kann man ab irgendeinem Punkt, wenn die Investition zu groß geworden ist, trotzdem praktisch nicht mehr zurück. Natürlich ist Assad in den Jahren des Bürgerkriegs wirklich ein blutiger Tyrann geworden, seine Armee hat viele Menschen getötet. Andererseits haben die, die gegen ihn kämpften, ungefähr genauso viele Menschen getötet – oder zumindest so viele, wie sie konnten. Aber was die Zeit vor dem Bürgerkrieg angeht, können Sie die komplette westliche Presse durchforsten: Zwischen 2004 und 2011, grob gesagt, werden Sie nicht einen Hinweis auf Assad als Geschwür am Leib der Menschheit finden, selbst in den kritischsten Menschenrechtsberichten nicht. Assad wird dort in etwa derselben Weise kritisiert wie die Diktatoren der Nachbarländer auch.
Eine massenhafte Unterstützung für das syrische Brudervolk zeichnet sich – anders als beim Thema Ukraine – in Russland nicht ab.
Die Welt besteht ungefähr zur Hälfte aus illiberalen Regimen. Innerhalb dieser Gruppe gibt es aber verschiedene Entwicklungstendenzen, die man beobachten muss. Wenn ein Land nicht frei ist, folgt daraus, dass wir schleunigst für den Sturz des dortigen Regimes sorgen müssen? Oder sollten wir erst einmal sehen, wer dieses Regime ablösen könnte? In Syrien geht es ja nicht nur um einen Regimewechsel. Der Preis dafür sind 250.000 Menschenleben und 4 Millionen Flüchtlinge. Ob die Sache diesen Preis wert ist, ist sehr die Frage – zumal die Lage vorher nicht so schrecklich war. Es gab die regional üblichen Repressionen. Ich verstehe, dass man bei dem Wort „Repressionen“ gerechten Zorn empfindet, aber im Grunde sah es in jedem anderen unfreien Land ganz genauso aus. Zu Beginn des arabischen Frühlings war Syrien ein wesentlich angenehmerer Ort als Saudi-Arabien oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar, vom Jemen ganz zu schweigen. Die ganze Region wird autoritär regiert; mit Ausnahme von Israel, dem Libanon und der Türkei, die fast schon zu Europa gehört, gibt es dort keine Demokratien.
Wer trägt die Hauptschuld an dem, was heute in Syrien geschieht?
Der Westen sagt: Assad hätte gleich abtreten müssen, dann wäre es nicht zum Bürgerkrieg gekommen. Ben Ali und Mubarak sind gegangen, und es gab keinen Bürgerkrieg. Nur, warum sind sie gegangen? Nicht aus freien Stücken, sondern weil der Machtapparat und die Bevölkerung ihrer Hauptstädte nicht mehr hinter ihnen standen. In Damaskus gab es keine großen Demonstrationen, alles fing in kleineren Provinzstädten in der sunnitischen Zone an. Es war nicht so, dass die örtlichen Liberalen und Demokraten auf die Straßen der Hauptstadt gegangen wären und den Rücktritt des Diktators gefordert hätten. Wenn Sunniten in einem überwiegend sunnitischen Gebiet gegen die gottlose Hauptstadt demonstrieren, dann kann man diesen Vorgang nicht guten Gewissens als Demokratiebewegung beschreiben. Insofern unterschied sich der Fall Syrien schon vom Beginn des arabischen Frühlings an stark von den anderen Fällen – eine kritische Masse von Demonstranten in der Hauptstadt gab es dort nicht. Und dann, wer hat überhaupt eine Vorstellung von den Namen und Gesichtern, die die syrische Demokratiebewegung ausmachen? Der Krieg dauert schon über vier Jahre, aber diese Leute sind im Grunde nicht vorhanden, oder nur sehr schemenhaft. Es gibt Sprecher, es gibt eine Leitung, aber Führer der Demokratiebewegung, bekannte Gesichter, Identifikationsfiguren, gibt es nicht. Wir haben also auf der einen Seite eine säkulare Diktatur, und auf der anderen etwas ziemlich Undefinierbares.
Der Westen sieht sich das derzeit an und überlegt, inwieweit das zutrifft und ob man Russland vertrauen kann.
Wäre es auch zu einem Bürgerkrieg gekommen, wenn Assad zurückgetreten wäre? Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Für einen Zerfall des Staates gab es in Syrien, wie auch in Libyen, durchaus eine Menge Voraussetzungen. Es gibt dort eine kurdische Zone, eine schiitische, eine alawitische und eine sunnitische. Die Leute hätten sich auch ohne Assad einfach gegenseitig abschlachten können, so wie man es im benachbarten Libanon zwanzig Jahre lang getan hat. Dafür braucht man keinen Diktator.
Die offizielle Position Russlands im Syrienkonflikt ist also ganz angemessen?
Wenn wir Syrien mit der Ukraine vergleichen, dann ist Russlands Position im ersten Fall wesentlich angemessener. Im Bezug auf die Ukraine wurde eine Unmenge von Mythen in die Welt gesetzt – in Bezug auf Syrien ist das anders. Hier konstruieren beide Seiten ihre Realität etwa im selben Maß. Der furchtbare, bei allen verhasste Assad ist ungefähr genauso eine Konstruktion wie eine Opposition, die ausschließlich aus Al-Qaida-Anhängern besteht. Aus dem, was man von russischen Regierungssprechern und Diplomaten hört, spricht nicht weniger vernünftige Einschätzung der Situation als aus den Reden von John Kerry.
Mit der Intervention in Syrien hat Russland sich aus einem Land, das Krieg gegen die Ukraine führt, in eines verwandelt, das die Islamisten bekriegt – ein wesentlich ehrenhafterer Status. Ein Ende des Krieges in der Ukraine würde an den Sanktionen natürlich nichts ändern und an der Rhetorik ebensowenig, aber bis dahin wird das alles schon Schnee von gestern sein. Man wird Russland nicht daran hindern, den IS zu bekämpfen, man wird nur verlangen, dass es die von der Opposition kontrollierten Gebiete nicht anfasst. Idealerweise werden auch die USA ihren Juniorpartnern das Signal geben, Assad in Ruhe zu lassen und sich auf den IS zu konzentrieren. Das Problem der Staatsführung muss man später lösen: Assad jetzt zu stürzen, wo der IS in den Vororten von Damaskus steht, wäre reiner Wahnsinn und völlig unverantwortlich, es würde nur zu noch mehr Blutvergießen führen. Dass man allerdings nach dem Ende des Konflikts nicht zum Vorkriegszustand zurückkehren kann, dem stimme ich absolut zu. Nach einem Bürgerkrieg kann nicht eine der Konfliktparteien friedlich regieren. Verantwortliches Handeln bestünde in meinen Augen jetzt darin, die Opposition und die Regierung daran zu hindern, sich gegenseitig auszuradieren. Beide Koalitionen – der Westen, die Opposition und die Kurden auf der einen Seite, und Assad, Russland und der Iran auf der anderen – müssen den IS zerschlagen und sich dann auf eine Übergangsregierung einigen, die verschiedene Kräfte einschließt. Und wahrscheinlich auch auf einen Rücktritt Assads, der das Land immerhin auch schon 15 Jahre regiert – lang genug. Aber bevor man die Haut der Hydra aufteilt, muss man sie erst einmal erlegen – und davon sind wir weit entfernt.
Welche Ziele verfolgt Russlands Führung in Syrien, und wie wird ihr Vorgehen im Inland wahrgenommen?
Eine massenhafte Unterstützung für das syrische Brudervolk zeichnet sich – anders als beim Thema Ukraine – in Russland nicht ab. Eine Ausnahme sind allenfalls die Patrioten unter den Politologen, die am liebsten ständig die Seekriegsflotte irgendwohin entsenden würden, weil wir schließlich eine Großmacht sind. In der Bevölkerung allgemein ist die Unterstützung dagegen ziemlich gering. Den Amerikanern zeigen, wo der Hammer hängt – ja, aber unsere Jungs nach Syrien schicken – damit erreicht man keine 86 Prozent Zustimmung. Wir haben es hier also nicht mit einem Versuch zu tun, die Umfragewerte [des Präsidenten – dek] zu verbessern und das Land zusammenzuschweißen. Das Ziel ist vielmehr ein diplomatisches: Es geht darum, die Isolation zu überwinden, in die Russland nach der Krim, dem Donbass und der Boeing geraten ist. Man versucht, ein neues Kapitel anzufangen, und wie wir sehen, durchaus mit Erfolg. Dahinter steht der Wunsch, sich mit dem Westen zu versöhnen, aber nicht, indem man auf Knien angekrochen kommt, sondern indem man seinen Einfluss und seine Unentbehrlichkeit demonstriert. Der Westen sieht sich das derzeit an und überlegt, inwieweit das zutrifft und ob man Russland vertrauen kann. Haben die Russen sich wieder einmal wie Leute verhalten, die nicht nach den Regeln spielen – oder wie eine eigenständige Macht, die sich dem amerikanischen Führungsanspruch zwar entzieht, mit der man aber trotzdem etwas zu tun haben kann? Wenn es keinerlei Chance einer Verständigung gäbe, dann hätten sich wohl weder Putin und Obama noch Lawrow und Kerry getroffen.
Weitere Themen
Russland als globaler Dissident
Warum sind Polizisten bestechlich?
Das Begräbnis des Essens
Welche Veränderungen hat 2014 gebracht?
Die unbemerkten Flüchtlinge
Ein neues Jalta auf den Trümmern Syriens?
Kontakt der Zivilisationen
Zerfall eines Konzerns: ein Szenario