Am 9. November 1933 sitzt Iwan Bunin in einem Pariser Kino. Plötzlich, inmitten der Vorführung, durchschneidet der Strahl einer Taschenlampe die Dunkelheit des Kinosaals: Man sucht Bunin. Jemand berührt seine Schulter und sagt mit leiser Stimme, aufgeregt, aber feierlich: „Ein Anruf aus Stockholm.“
Die Nachricht, dass der Emigrant Bunin als erster russischsprachiger Schriftsteller den Literaturnobelpreis bekommt, wird im „Russland jenseits der Grenzen“, wie man die russische Emigration nach der Revolution bezeichnete, euphorisch aufgenommen: „Er ist gekrönt. Ja, endlich zu Recht gekrönt, in aller Welt. Aber wir auch, wir sind auch irgendwie belohnt, gütig behandelt, entgolten“, schreibt ein Kritiker. Bunins Heimat, die seit der Oktoberrevolution unter bolschewistischer Fahne stand, lässt dieses historische Ereignis jedoch lautlos vorüberziehen. Bunins Texte durften in Russland erst wieder nach seinem Tod 1953 publiziert werden.
Zum 150. Geburtstag Iwan Bunins veröffentlicht dekoder seine Erzählung Leichter Atem, die Dorothea Trottenberg für die deutsche Werkausgabe Bunins im Dörlemann Verlag neu ins Deutsche übertrug. Bunin kleidet ein äußerst simples Sujet in meisterhafte Form – dafür wurde die Erzählung schon von Zeitgenossen „zu einem der besten Werke der Erzählkunst“ (Lew Wygotski) erklärt. Sie ist am 10. April 1916 erstmals in der Moskauer Zeitung Russkoje Slowo erschienen, heute gehört sie zum Kanon der klassischen russischen Literatur.
Auf dem Friedhof, über einem frisch aufgeschütteten Lehmhügel, steht ein neues Kreuz aus Eiche, fest, schwer und glatt, eines, das schön anzusehen ist.
Es ist April, aber die Tage sind grau: Die Grabmale des Friedhofs, eines weitläufigen, richtigen Kreisstadtfriedhofs, sind zwischen den kahlen Bäumen noch weithin zu sehen, und der kalte Wind klirrt in einem fort mit dem Porzellankranz am Fuße des Kreuzes.
In das Kreuz eingelassen ist ein vergleichsweise großes, bronzenes Medaillon, und darin befindet sich das photographische Portrait einer adretten, reizenden Gymnasiastin mit freudestrahlenden, verblüffend lebendigen Augen.
Das ist Olja Meschtscherskaja.
Als kleines Mädchen hatte sie sich durch nichts hervorgetan in der lärmenden Menge brauner Kleidchen, die so dissonant und jung durch Korridore und Klassenzimmer hallte; was konnte man sagen über sie, abgesehen davon, dass sie zu den hübschen, reichen und glücklichen Mädchen zählte, dass sie begabt, aber mutwillig war und die Ermahnungen der Klassendame geflissentlich überhörte? Später erblühte sie, entwickelte sich nicht in Tagen, sondern in Stunden. Mit vierzehn Jahren zeichneten sich, bei zarter Taille und schlanken Beinen, bereits deutlich die Brüste und all jene Formen ab, deren Zauber noch kein menschliches Wort je auszudrücken vermochte; mit fünfzehn galt sie als Schönheit. Wie sorgfältig einige ihrer Freundinnen sich das Haar legten, wie reinlich sie waren, wie sehr sie darauf achteten, sich sittsam zu bewegen! Sie aber fürchtete nichts – weder Tintenflecke an den Fingern oder ein rot angelaufenes Gesicht noch zerzauste Haare oder ein entblößtes Knie, wenn sie beim Laufen stürzte. Ohne Zutun und Bemühen ihrerseits und gewissermaßen unmerklich fiel ihr all das zu, was sie in den letzten beiden Jahren unter all den Mädchen am Gymnasium so hervorhob: Eleganz, Anmut, Geschick und der heitere, aber hellwache Glanz ihrer Augen. Niemand tanzte wie Olja Meschtscherskaja, niemand lief Schlittschuh wie sie, niemand wurde auf dem Ball so eifrig umworben, und niemand war, warum auch immer, bei den unteren Klassen so beliebt wie sie. Unmerklich wuchs sie zu einer jungen Frau heran, unmerklich festigte sich ihr Ruf am Gymnasium, und schon gingen Gerüchte, sie sei leichtfertig, sie könne ohne Verehrer nicht leben, der Gymnasiast Schtschenschin sei bis zum Wahnsinn verliebt in sie und sie liebe ihn ebenfalls, sei aber so flatterhaft im Umgang mit ihm, dass er versucht habe, sich das Leben zu nehmen …
In ihrem letzten Winter hatte Olja Meschtscherskaja vor Übermut nachgerade den Verstand verloren, wie man im Gymnasium erzählte. Der Winter war schneereich, sonnig und frostkalt, die Sonne versank früh, aber gleichbleibend schön und strahlend hinter dem hohen Fichtenhain im verschneiten Garten des Gymnasiums und versprach für den folgenden Tag erneut Frost und Sonne, Flanieren auf der Sobornaja-Straße, Schlittschuhlaufen im Stadtgarten, einen blaßroten Abend, Musik und jene in alle Richtungen gleitende Menge, in der Olja Meschtscherskaja die Anmutigste, Sorgloseste und Glücklichste schien. Eines Tages, in der großen Pause, als sie wie ein Wirbelwind durch die Aula stürmte und den Schülerinnen der ersten Klasse zu entkommen versuchte, die verzückt kreischend hinter ihr herliefen, wurde sie unverhofft zur Schulvorsteherin gerufen. Sie blieb abrupt stehen, tat einen einzigen tiefen Seufzer, ordnete mit raschem, geübtem Griff ihr Haar, zog die Zierecken ihrer Schürze zu den Schultern hin auseinander und lief mit blitzenden Augen nach oben. Die Vorsteherin, eine kleine, noch jugendliche, aber schon weißhaarige Frau, saß mit einer Strickarbeit in der Hand ruhig an ihrem Schreibtisch unter einem Portrait des Zaren.
„Guten Tag, Mademoiselle Meschtscherskaja“, sagte sie auf französisch, ohne den Blick von ihrer Strickarbeit zu heben. „Ich sehe mich leider nicht zum ersten Mal veranlasst, Sie herzurufen, um mit Ihnen über Ihr Benehmen zu sprechen.“
„Ich höre Ihnen zu, Madame“, erwiderte die Meschtscherskaja und trat näher zum Tisch, wobei sie die Vorsteherin klar und wach, aber mit völlig ausdruckslosem Gesicht anblickte und so leicht und graziös knickste, wie nur sie es verstand.
„Zuhören werden Sie mir schlecht, davon konnte ich mich zu meinem Leidwesen bereits überzeugen“, sagte die Vorsteherin, zupfte an ihrem Wollfaden, so dass das Knäuel über den lackierten Fußboden rollte, was die Meschtscherskaja neugierig beobachtete, und hob die Augen: „Ich werde mich nicht wiederholen, mich nicht in langen Reden ergehen“, sagte sie.
Der Meschtscherskaja gefiel dieses bemerkenswert saubere, große Kabinett sehr gut, in dem der blanke Kachelofen an frostkalten Tagen wohlige Wärme verbreitete und die Maiglöckchen auf dem Schreibtisch einen frischen Duft verströmten. Sie blickte auf den jungen Zaren, der in voller Lebensgröße mitten in einem glanzvollen Saal gemalt war, auf den geraden Scheitel in dem milchweißen, akkurat in Wellen gelegten Haar der Vorsteherin und schwieg abwartend.
„Sie sind kein kleines Mädchen mehr“, begann die Vorsteherin, die sich insgeheim schon ärgerte, vielsagend.
„Ja, Madame“, erwiderte die Meschtscherskaja schlicht, fast heiter.
„Aber auch noch keine Frau“, fuhr die Vorsteherin noch vielsagender fort, und ihr fahles Gesicht rötete sich leicht. „Zunächst einmal: Was soll diese Frisur? Das ist die Frisur einer erwachsenen Frau!“
„Ich bin nicht schuld, Madame, dass ich schöne Haare habe“, erwiderte die Meschtscherskaja und berührte mit beiden Händen flüchtig ihren apart coiffierten Kopf.
„Ach so ist das, Sie sind nicht schuld!“ versetzte die Vorsteherin. „Sie sind nicht schuld an der Frisur, nicht schuld an diesen teuren Kämmen, nicht schuld, dass Sie Ihre Eltern mit Schuhen für zwanzig Rubel ruinieren! Aber ich sage Ihnen noch einmal, Sie lassen vollkommen außer Acht, dass Sie vorläufig nur eine Gymnasiastin sind …“
Da fiel die Meschtscherskaja, ohne ihre Bescheidenheit und Gelassenheit zu verlieren, ihr unvermittelt ins Wort und sagte höflich:
„Verzeihen Sie, Madame, Sie irren sich: Ich bin eine Frau. Und wissen Sie, wer schuld daran ist? Papas Freund und Nachbar – Ihr Bruder, Alexej Michajlowitsch Maljutin. Es geschah im vergangenen Sommer auf dem Lande …“
Einen Monat nach diesem Gespräch hatte ein Kosakenoffizier von hässlichem, plebejischem Aussehen, der rein gar nichts gemein hatte mit jenem Kreis, zu dem Olja Meschtscherskaja gehörte, sie auf dem Bahnsteig erschossen, inmitten einer großen Menge von Menschen, die soeben mit dem Zug eingetroffen waren. Und Olja Meschtscherskajas unglaubliches Bekenntnis, das die Schulvorsteherin so erschüttert hatte, erwies sich als vollkommen richtig: Der Offizier erklärte dem Untersuchungsrichter, die Meschtscherskaja habe ihn verführt, in einer intimen Beziehung mit ihm gestanden und geschworen, seine Frau zu werden, aber am Tag des Mordes, als sie ihn zum Bahnhof begleitete, wo er nach Nowotscherkassk abreisen wollte, habe sie ihm plötzlich eröffnet, dass sie niemals auch nur daran gedacht habe, ihn zu lieben, und all das Gerede von Ehe ihrerseits blanker Hohn gewesen sei, woraufhin sie ihm jene Seite ihres Tagebuchs zu lesen gegeben habe, in der von Maljutin die Rede war.
„Ich überflog diese Zeilen, trat hinaus auf den Bahnsteig, wo sie auf und ab ging und wartete, dass ich zu Ende las, und schoss auf sie“, sagte der Offizier. „Das Tagebuch ist noch in der Tasche meines Uniformmantels, schauen Sie nach, was da am zehnten Juli des vergangenen Jahres geschrieben steht.“
Der Untersuchungsrichter las etwa Folgendes:
„Es ist nach ein Uhr in der Nacht. Ich war fest eingeschlafen, bin aber sofort wieder erwacht … Heute bin ich zur Frau geworden! Papa, Mama und Tolja, sie alle waren in die Stadt gefahren, und ich blieb allein zu Hause. Ich war so glücklich, allein zu sein, daß ich es gar nicht sagen kann! Am Morgen ging ich allein spazieren, im Garten, über die Felder, im Wald, mir schien, ich sei ganz allein auf der Welt, ich war in tiefes Nachdenken versunken, wie nie zuvor in meinem Leben. Ich aß auch allein zu Mittag und spielte danach eine ganze Stunde Klavier, und ich hatte das Gefühl, dass ich ewig leben und so glücklich sein würde wie nie zuvor! Dann schlief ich ein, in Papas Kabinett, und um vier Uhr weckte mich Katja und sagte, Alexej Michajlowitsch sei gekommen. Ich freute mich sehr, es war schön, ihn zu empfangen und zu unterhalten. Er hatte zwei Wjatkapferde vorgespannt, sehr schöne Tiere, sie blieben an der Vortreppe stehen, aber er kam herein und blieb, weil es regnete und er hoffte, dass es zum Abend hin aufhören würde. Es tat ihm sehr leid, daß er Papa nicht antraf, er war sehr lebhaft, verhielt sich mir gegenüber wie ein Kavalier und scherzte, er sei seit langem verliebt in mich. Als wir vor dem Tee im Garten spazierengingen, war wieder schönstes Wetter, die Sonne glitzerte durch den nassen Garten, aber es war sehr kühl geworden, und er führte mich am Arm und sagte, wir seien Faust und Gretchen. Er ist sechsundfünfzig Jahre alt, aber noch sehr gutaussehend und stets gut angezogen – nur dass er einen Havelock trug, gefiel mir nicht –, er duftet nach englischem Eau de Cologne und hat ganz junge, schwarze Augen, und sein Bart ist elegant in zwei lange Hälften geteilt und ganz silbrig. Zum Tee saßen wir auf der verglasten Veranda, und da mir war, als wäre ich nicht ganz gesund, legte ich mich auf die Ottomane, er rauchte und setzte sich zu mir, sagte mir wieder allerlei Liebenswürdigkeiten, besah sich dann meine Hand und küsste sie. Ich bedeckte das Gesicht mit einem seidenen Tuch, und er küsste mich mehrmals durch das Tuch hindurch auf den Mund … Ich begreife nicht, wie das geschehen konnte, ich habe den Verstand verloren, ich hätte nie gedacht, daß ich so eine sein könnte! Jetzt bleibt mir nur ein Ausweg … Ich empfinde eine solche Abscheu ihm gegenüber, dass ich nicht mehr leben kann! …“
Die Stadt ist in diesen Apriltagen wieder sauber und trocken, die Steine sind wieder weiß, es ist bequem und angenehm, auf ihnen zu gehen. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst geht eine kleine Frau in Trauerkleidung, mit schwarzen Glacéhandschuhen und einem Schirm mit Ebenholzgriff über die Sobornaja-Straße, die zur Stadt hinausführt. Sie passiert die Feuerwache, überquert den schmutzigen Platz, an dem etliche rauchgeschwärzte Schmieden stehen und vom Feld her ein frischer Wind weht; zwischen dem Mönchskloster und dem Gefängnis schimmern weiß der bewölkte Himmelsbogen und grau das Frühlingsfeld; schlüpft man dann hindurch zwischen den Pfützen an der Klostermauer und wendet sich nach links, sieht man eine Art großen, niedrigen Garten, eingefasst von einer weißen Mauer, über deren Tor die Entschlafung der Gottesmutter gemalt ist. Die kleine Frau bekreuzigt sich diskret und geht der Gewohnheit folgend die Hauptallee hinunter. Wenn sie die Bank gegenüber dem Eichenkreuz erreicht, setzt sie sich, Wind und Frühlingskälte trotzend, für ein, zwei Stunden hin, bis ihre Füße in den leichten Schuhen und die Hände in den schmalen Handschuhen völlig durchfroren sind. Während sie den Frühlingsvögeln lauscht, die auch in der Kälte lieblich singen, und dem Klang des Windes im Porzellankranz, denkt sie zuweilen, dass sie ihr halbes Leben geben würde, wenn sie dafür nicht diesen Totenkranz vor Augen haben müsste. Der Gedanke, daß man Olja Meschtscherskaja in diesem Lehm vergraben hat, versetzt sie in ein an Apathie grenzendes Erstaunen: Wie soll man die sechzehnjährige Gymnasiastin, die noch vor zwei, drei Monaten so voller Leben, Liebreiz und Heiterkeit war, zusammenbringen mit diesem Lehmhügel und diesem Eichenkreuz? Ist es möglich, dass darunter diejenige liegt, deren Augen aus diesem bronzenen Medaillon heraus so unsterblich strahlen, und wie lässt sich mit diesem klaren Blick jenes Entsetzliche in Einklang bringen, das nun mit dem Namen Olja Meschtscherskaja verbunden ist? In der Tiefe ihrer Seele aber ist die kleine Frau glücklich, so wie alle verliebten oder überhaupt einem leidenschaftlichen Wunschtraum ergebenen Menschen.
Diese Frau ist Olja Meschtscherskajas Klassendame, ein Fräulein jenseits der dreißig, die seit langem mit ihren Phantasien lebt, die ihr das wirkliche Leben ersetzen. Zuerst war ihr Bruder der Gegenstand ihrer Phantasie, ein armer, unscheinbarer Fähnrich – sie hatte ihre ganze Seele mit ihm verbunden, mit seiner Zukunft, die sich ihr, warum auch immer, in leuchtenden Farben darstellte, und in der seltsamen Erwartung gelebt, ihr Schicksal würde dank ihres Bruders eine märchenhafte Wendung nehmen. Nachdem er in der Schlacht bei Mukden gefallen war, hatte sie sich eingeredet, dass sie zu ihrem großen Glück anders sei als die anderen, dass Geist und höhere Interessen ihr Schönheit und Weiblichkeit ersetzten und sie eine Arbeiterin des Geistes sei.
Der Tod von Olja Meschtscherskaja hält sie mit einem neuen Traum in Bann. Nun ist Olja Meschtscherskaja der Gegenstand ihres unablässigen Sinnens und Trachtens, ihrer Begeisterung und Freude. Sie geht an jedem Sonn- und Feiertag zu Oljas Grab – die Gewohnheit, zum Friedhof zu gehen und Trauer zu tragen, hat sie nach dem Tod des Bruders angenommen –, blickt stundenlang unverwandt auf das Eichenkreuz, denkt an Olja Meschtscherskajas bleiches Gesichtchen im Sarg, inmitten von Blumen, und daran, was sie einmal zufällig mitangehört hatte: Einmal in der großen Pause, als sie im Garten des Gymnasiums spazierengingen, hatte Olja Meschtscherskaja ihrer besten Freundin, der fülligen, hochgewachsenen Subbotina, hastig zugeflüstert:
„In einem von Papas Büchern – er hat viele altertümliche, komische Bücher – habe ich gelesen, was die Schönheit einer Frau ausmacht … Weißt du, da steht so allerlei, man kann sich gar nicht alles merken: schwarze Augen natürlich, wie siedendes Pech – wahrhaftig, so steht es da: siedendes Pech! –, nachtschwarze Wimpern und ein zart schimmerndes Wangenrot, eine schlanke Statur, außergewöhnlich lange Hände – verstehst du: außergewöhnlich lange! –, ein kleiner Fuß, eine ausreichend große Büste, eine ebenmäßig gerundete Wade, das Knie in der Farbe von Muschelschalen, abfallende, aber kräftige Schultern – vieles weiß ich fast auswendig, so sehr trifft das alles zu! – vor allem aber, weißt du was? – ein leichter Atem! Den habe ich doch – höre nur, wie ich atme – nicht wahr, den habe ich?“
Nun ist dieser leichte Atem wieder verweht in der Welt, in diesem wolkenverhangenen Himmel, in diesem kalten Frühlingswind …
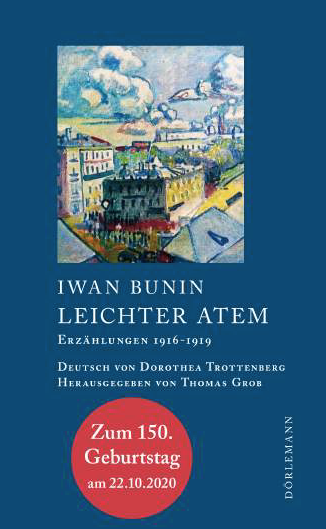
Erste Veröffentlichung der Erzählung: Zeitschrift Russkoje Slowo, 1916, Nr. 83