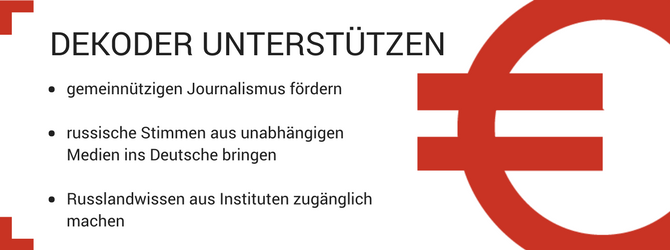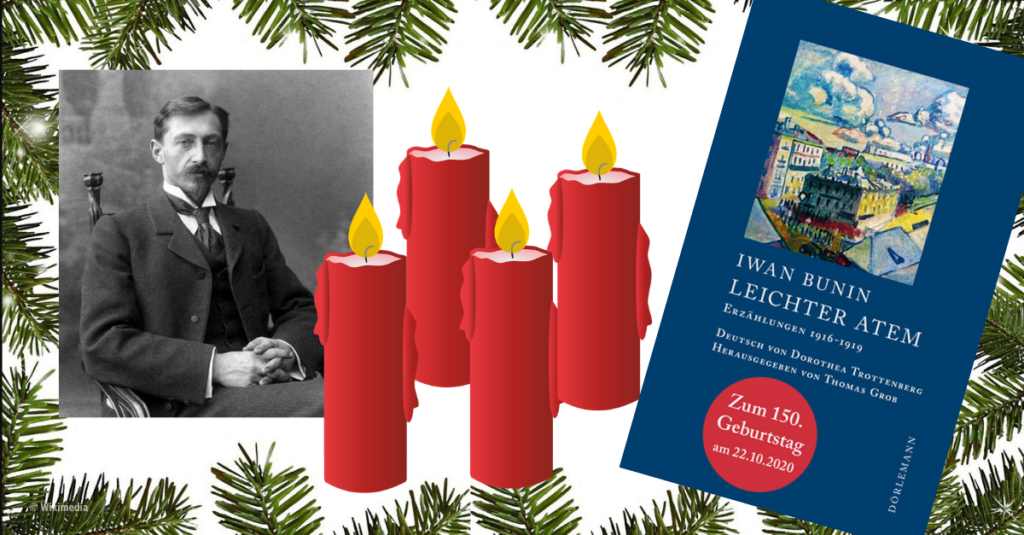-
Debattenschau № 81: Tumult in Washington

Weihnachtsgeschenk für die Kreml-Propaganda? Die Reaktionen aus Russland auf die Eskalation im US-Kapitol reichen von Spott bis Betroffenheit – ein Zusammenschnitt.
-
Mit der Angst um den Hals

Der Faschismus ist in Belarus wieder in aller Munde: Der Schriftsteller Alhierd Bacharevič erzählt, was es mit diesem wechselvollen Begriff in seiner Heimat auf sich hat.
-
Alexander Gronsky: 2018

Ein Ironija sudby der Fotografie: urbane Triptycha aus Moskau und Sankt Petersburg. Finde den Unterschied!
-
Das Unterhosen-Gate

Das aktuelle Video des nicht-zu-Ende-ermordeten Nawalnys hat dem putinschen Hauptmythos FSB einen heftigen Schlag verpasst. Von Kirill Rogow.
-
ZITAT #11: „Es gibt keinen Tiefpunkt, es ist der freie Fall ins Bodenlose“

Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Auch nicht nach den Aufsehen erregenden Recherchen zu Nawalnys Vergiftung, auch nicht nach Putins Stellungnahme dazu. Sergej Medwedew beschreibt, warum das so ist.
-
4. Advent: Bunin, 10. Band

Advent, Advent auf dekoder: Jeden Adventssonntag zünden wir hier zwar kein Kerzchen an, aber Gnosisten und Klubmitglieder geben ausgesuchte Geschenk-, Lese- oder einfach Kulturtipps. Erst eins, dann zwei, dann drei,…
-
„Wer gehen will, geht leise“

Er quittierte den Dienst. Ein Interview mit einem ehemaligen Mitarbeiter bei den Truppen des Inneren, die bei den Protesten in Belarus zum Einsatz kommen.
-
„Ich erlaube mir, ich zu sein“

„Die Geschichte meiner Held*innen ist nicht die Geschichte des Kampfes einer bestimmten Community, sondern der Kampf für ein grundlegendes Menschenrecht – das Recht zu sein.“ Zum Tag der Menschenrechte bringt dekoder…
-
„Es lebe Belarus“: Woher kommt die Losung?

Über den historischen Ursprung und die kulturelle Entwicklung des Leitrufs, der seit Monaten die Proteste in Belarus begleitet.
-
Editorial: Warum wir nun auch Belarus entschlüsseln

Seien wir ehrlich: Wir wissen kaum etwas über Belarus. Ich selbst bin 1995 als Student der Osteuropäischen Geschichte und Slawistik zum ersten Mal nach Belarus gereist. Ein Land, von dem…
дekoder | DEKODER
Journalismus aus Russland und Belarus in deutscher Übersetzung